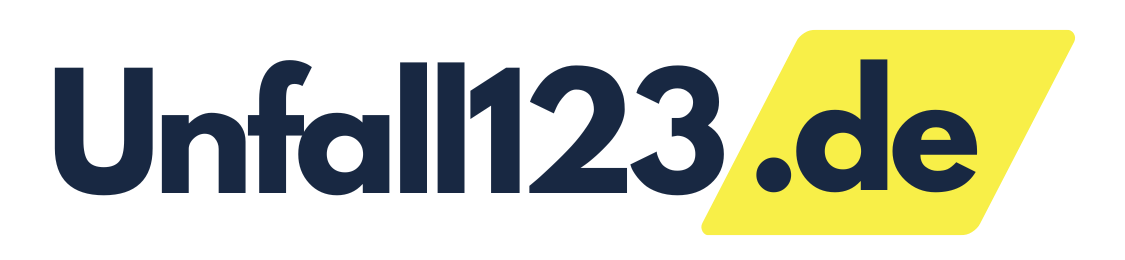Ein Verkehrsunfall, an dem Sie keine Schuld tragen, kann jeden treffen – und er bringt viele Fragen und Unsicherheiten mit sich. Was muss ich unmittelbar nach dem Unfall tun? Welche Rechte habe ich als Geschädigter? Sollte ich einen Gutachter oder Anwalt einschalten, und wer zahlt das eigentlich? Wie läuft die Schadensregulierung ab, und welche Schadenspositionen stehen mir zu? Wie gehe ich mit der gegnerischen Versicherung um, und worauf muss ich achten, um nicht benachteiligt zu werden? Dieser Ratgeber gibt Ihnen leicht verständliche, fundierte und praktische Antworten auf all diese Fragen. Schritt für Schritt führen wir Sie durch die Situation – von der Unfallstelle bis zur Entschädigung – damit Sie Ihre Rechte kennen und durchsetzen können. Denn eins ist klar: Die gegnerische Versicherung ist nicht Ihr Freund, sondern Ihr Gegner, der möglichst wenig zahlen. Lassen Sie sich also nicht einschüchtern! Mit dem Wissen aus diesem Ratgeber sind Sie bestens gewappnet, um Ihren Anspruch auf vollen Schadensersatz durchzusetzen – kompetent, selbstbewusst und ohne unnötigen Stress.
Inhaltsverzeichnis
Direkt nach dem Unfall – Sofortmaßnahmen und Unfallstelle sichern
Ein Verkehrsunfall ist zunächst einmal ein Ausnahmezustand. Selbst ein scheinbar kleiner „Blechschaden“ kann Schock, Stress und Unsicherheit auslösen. Umso wichtiger ist es, direkt nach dem Zusammenstoß ruhig und strukturiert vorzugehen. Die folgenden ersten Schritte dienen Ihrer Sicherheit und der Dokumentation des Unfalls – beides ist entscheidend, um später Ihre Ansprüche erfolgreich geltend zu machen.
- Unfallstelle absichern: Stellen Sie Ihr Fahrzeug – sofern fahrbereit – möglichst am Fahrbahnrand ab und schalten Sie den Warnblinker ein. Legen Sie Ihre Warnweste an, bevor Sie aussteigen (in Deutschland besteht Warnwestenpflicht laut § 53a StVZO). Stellen Sie dann ein Warndreieck auf, um nachfolgende Verkehrsteilnehmer zu warnen. Beachten Sie die empfohlenen Mindestentfernungen: ca. 50 m innerorts, 100 m außerorts und 150–200 m auf der Autobahn vom Unfallort. Besonders bei Dunkelheit oder schlechter Sicht sollten Sie auf Ihre eigene Sichtbarkeit achten – nutzen Sie eine Taschenlampe oder das Handylicht und stellen Sie ggf. zusätzliche reflektierende Warnmittel.
- Verletzten helfen: Prüfen Sie, ob jemand verletzt wurde, und leisten Sie Erste Hilfe. Das ist nicht nur moralisch geboten, sondern auch Ihre Rechtspflicht (§ 323c StGB: Unterlassene Hilfeleistung). Zögern Sie nicht, den Rettungsdienst unter 112 zu rufen, selbst bei scheinbar leichten Verletzungen. Wer hilft, kann nichts falsch machen – unterlassen Sie jedoch Hilfe, machen Sie sich unter Umständen strafbar. Sorgen Sie also dafür, dass Verletzte versorgt werden, bis professionelle Hilfe eintrifft.
- Polizei verständigen – ja oder nein? In vielen Fällen ist es ratsam, die Polizei zu rufen, insbesondere wenn:
- jemand verletzt wurde,
- hoher Sachschaden entstanden ist,
- der Unfallhergang strittig ist oder
- der Unfallgegner sich möglicherweise unerlaubt entfernt (Fahrerflucht).
Bei Bagatellunfällen ohne Personenschaden und mit klarer Sachlage kann man theoretisch auf die Polizei verzichten. Unsere Empfehlung: Im Zweifel lieber immer die Polizei hinzuziehen. Die Polizeibeamten sichern Spuren, nehmen ein Protokoll auf und helfen bei der gegenseitigen Datenerfassung. Ein offizieller Unfallbericht der Polizei ist später ein wertvoller Nachweis. Sollte die Polizei einmal nicht kommen (z.B. bei sehr geringem Schaden und Überlastung der Notrufleitstelle), ist es umso wichtiger, dass Sie selbst alle relevanten Daten aufnehmen (siehe Kapitel 2).
- Eigene Sicherheit und Ruhe bewahren: Nachdem die Unfallstelle gesichert und die notwendigen Dienste informiert sind, atmen Sie tief durch. Vermeiden Sie Streit und Schuldzuweisungen am Unfallort. Diskutieren Sie nicht lautstark mit dem Unfallgegner über die Schuldfrage – diese lässt sich oft erst später klären und wird notfalls von Gutachtern oder Gerichten bewertet. Bleiben Sie sachlich und höflich, auch wenn Sie verärgert sind. Ruhiges Verhalten signalisiert Souveränität und kann später Ihrer Position helfen.
- Austausch von Personalien: Tauschen Sie mit dem Unfallgegner Namen, Adressen, Telefonnummern und Kfz-Kennzeichen aus. Notieren Sie auch die Versicherung des Unfallgegners (Versicherungsname und Policennummer, falls bekannt). Lassen Sie sich am besten den Führerschein und die Zulassung des anderen zeigen, um Tippfehler zu vermeiden. Fotografieren Sie diese Dokumente bei Einverständnis des Gegenübers. Wichtig: Geben Sie selbst keinerlei Schuldeingeständnis ab! Sätze wie „Es war meine Schuld“ oder „Ich habe Sie wohl übersehen“ sollten Sie unbedingt vermeiden, so verständlich der Impuls auch sein mag. Solche Äußerungen können Ihnen später negativ ausgelegt werden. Bleiben Sie bei der Aufnahme der Daten neutral. Wenn die Polizei vor Ort ist, schildern Sie den Beamten den Ablauf aus Ihrer Sicht, aber unterschreiben Sie kein Schuldanerkenntnis – das ist vor Ort auch gar nicht erforderlich.
Beweise sichern und Unfall dokumentieren
Eine gründliche Dokumentation des Unfallhergangs und der Schäden ist das A und O, um Ihre Ansprüche später durchzusetzen. Je mehr Beweise Sie sichern, desto besser lässt sich rekonstruieren, was passiert ist – und desto schwerer wird es für die gegnerische Versicherung, berechtigte Forderungen abzustreiten. Gehen Sie Schritt für Schritt vor:
- Unfall fotografieren: Machen Sie möglichst umfassende Fotos von der Unfallstelle und den beteiligten Fahrzeugen. Wichtig sind:
- Übersichtsaufnahmen (Position der Fahrzeuge zueinander, Umgebung, Bremsspuren, Verkehrszeichen),
- Detailfotos der Schäden an allen Fahrzeugen,
- Nahaufnahmen von Splittern, Flüssigkeiten auf der Straße usw.
Machen Sie die Fotos aus verschiedenen Winkeln und Distanzen, auch von Kennzeichen und eventuell von der Umgebung (z.B. Kreuzung, Ampel, Straßennamen). Achten Sie auf eigene Sicherheit dabei (z.B. nicht auf der Fahrbahn stehen). Diese Bilder dienen später als Beweismittel, falls Hergang oder Schadenshöhe strittig werden.
- Unfallskizze anfertigen: Falls möglich, zeichnen Sie eine einfache Skizze des Unfalls auf (zur Not auf einem Blatt Papier oder in der Notiz-App Ihres Handys). Markieren Sie die Straßen, die Fahrtrichtungen, die ungefähre Position der Fahrzeuge beim Zusammenstoß und danach. Notieren Sie auch Datum, Uhrzeit und Wetter-/Straßenverhältnisse. Eine Skizze ergänzt die Fotos und hilft, den Ablauf zu veranschaulichen.
- Europäischer Unfallbericht: Viele Autofahrer haben einen Europäischen Unfallbericht im Handschuhfach. Dieses Formular ist sehr hilfreich, um strukturiert alle relevanten Informationen aufzunehmen. Wenn beide Parteien einverstanden sind, füllen Sie gemeinsam einen Unfallbericht aus. Tragen Sie alle Fakten ein (Personalien, Fahrzeuge, Versicherung, Unfallhergang in kurzen Worten). Wichtig: Kreuzen Sie auf keinen Fall vorschnell irgendwelche Schuldanzeigen an und unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht genau geprüft haben. Der Unfallbericht ist kein Schuldeingeständnis, sondern dient der Sachverhaltsdarstellung. Achten Sie darauf, dass jede Partei ein Exemplar erhält (das Formular ist meist selbstdurchschreibend).
- Zeugen sichern: Schauen Sie sich um, ob es Zeugen des Unfalls gibt – z.B. andere Autofahrer, Fußgänger, Anwohner. Sprechen Sie diese Personen an und bitten Sie um ihre Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer). Unabhängige Zeugen können im Zweifel entscheidend sein. Viele Menschen sind spontan hilfsbereit, aber verschwinden schnell vom Ort, wenn sie es eilig haben – daher zögern Sie nicht, jemanden direkt anzusprechen. Notieren Sie, was der Zeuge beobachtet hat (zur Not als Stichpunkte). Die Aussage eines neutralen Zeugen kann Ihre Schilderung untermauern, gerade wenn der Unfallgegner eine andere Version präsentiert.
- Zum Arzt gehen – auch ohne sichtbare Verletzungen: Nicht jeder Personenschaden ist sofort offensichtlich. Verletzungen wie ein Schleudertrauma (Halswirbelsäulen-Distortion), innere Prellungen oder Schocksymptome zeigen sich oft erst Stunden später. Daher gilt: Lassen Sie sich nach dem Unfall medizinisch untersuchen, selbst wenn Sie sich zunächst okay fühlen. Ein Arzt kann eventuelle Verletzungen frühzeitig diagnostizieren und dokumentieren. Diese ärztliche Dokumentation ist wichtig, falls Sie Schmerzensgeld oder Heilbehandlungskosten geltend machen (siehe Kapitel 6 und 9). Zudem sichern Sie Ihre Gesundheit – manche Verletzungen sollten sofort behandelt werden. Bewahren Sie alle Arztberichte und Atteste gut auf, sie dienen als Nachweis für unfallbedingte Verletzungen.
Zusammengefasst: Durch sorgfältiges Sichern von Beweisen – Fotos, Notizen, Zeugen, Bericht – schaffen Sie eine solide Grundlage für die spätere Regulierung. Je besser die Beweislage, desto höher die Chance, dass Ihre Ansprüche voll anerkannt werden. Versäumen Sie in der Hektik nichts Wesentliches; nutzen Sie auch unsere Checkliste (siehe Anhang, falls vorhanden), um keinen Schritt zu vergessen.
Ihre Rechte als Geschädigter verstehen
Wenn Sie an einem Unfall ohne eigenes Verschulden beteiligt sind, haben Sie nach deutschem Recht klare Ansprüche. Grundlage ist § 249 BGB, der vorsieht, dass der Verursacher bzw. dessen Haftpflichtversicherung Ihnen den gesamten entstandenen Schaden ersetzen muss. Ziel ist es, Sie so zu stellen, wie Sie stünden, wenn der Unfall nie passiert wäre. Das heißt: Alle Kosten und Nachteile, die Ihnen durch den Unfall entstehen, müssen ausgeglichen werden. Dieses Prinzip nennt man „Naturalrestitution“, und es umfasst weit mehr als nur die reinen Reparaturkosten.
Wichtig zu wissen: Sie als Geschädigter sollen keine finanziellen Lasten tragen müssen, wenn Sie keine Schuld am Unfall tragen. Das schließt auch Dienstleistungen ein, die zur Regulierung nötig sind. Daher gehört es zu Ihren Rechten, einen unabhängigen Kfz-Gutachter zur Schadenfeststellung zu beauftragen und einen Rechtsanwalt mit der Schadensabwicklung zu betrauen – die Kosten dafür muss ebenfalls die gegnerische Versicherung übernehmen. Dieses Prinzip dient der Waffengleichheit: Die Versicherung hat Experten und Juristen; Sie sollen dem nicht schutzlos gegenüberstehen, sondern sich ebenfalls fachkundig vertreten lassen dürfen, ohne auf den Kosten sitzenzubleiben.
Hier ein Überblick über Ihre wesentlichen Rechte als Unfallgeschädigter in Deutschland:
- Anspruch auf vollen Schadensersatz: Wie oben erwähnt, umfasst das alle direkten und indirekten Schäden. Von den Reparaturkosten über einen Nutzungsausfall oder Mietwagen bis hin zu Wertminderung, Abschleppkosten, Anwaltsgebühren und Schmerzensgeld (bei Verletzungen) – jede Position, die unfallbedingt anfällt, muss ersetzt werden. In Kapitel 6 listen wir ausführlich bis zu 16 mögliche Schadensposten auf.
- Freie Wahl des Gutachters: Sie dürfen selbst einen qualifizierten Kfz-Sachverständigen auswählen, der den Schaden an Ihrem Fahrzeug begutachtet. Lassen Sie sich nicht auf einen Gutachter der gegnerischen Versicherung verweisen! (Warum, dazu später mehr.) Der von Ihnen beauftragte Gutachter erstellt ein unabhängiges Gutachten; dessen Kosten fallen unter den Schadenersatz.
- Freie Wahl des Anwalts: Ebenso steht es Ihnen frei, einen Verkehrsrechtsanwalt Ihres Vertrauens hinzuzuziehen. Informierte Geschädigte tun dies nahezu immer, weil der Anwalt Ihre Ansprüche kennt und durchsetzen kann – und Sie nichts dafür bezahlen müssen (die Kosten trägt die Gegenseite bei Fremdverschulden).
- Freie Wahl der Werkstatt: Sie entscheiden, wo Ihr Fahrzeug repariert wird, sofern Sie reparieren lassen. Es kann die Vertragswerkstatt Ihrer Automarke sein oder eine Fachwerkstatt Ihres Vertrauens. Die gegnerische Versicherung darf Ihnen nicht vorschreiben, in eine Partnerwerkstatt zu gehen oder Billiglösungen zu akzeptieren. Sie müssen sich auch nicht mit einer Notreparatur begnügen – fachgerechte vollständige Instandsetzung ist geschuldet, soweit technisch und wirtschaftlich vertretbar.
- Anspruch auf Ersatz des Wertverlustes: Ist Ihr Wagen nach dem Unfall repariert, bleibt oft ein merkantiler Minderwert – das Fahrzeug ist nun ein „Unfallwagen“ und beim Wiederverkauf weniger wert. Diesen Wertverlust können Sie ersetzt verlangen (Details in Kapitel 6).
- Anspruch auf Nutzungsausfall oder Mietwagen: Während Ihr Auto repariert wird (oder Sie auf ein Ersatzfahrzeug warten), haben Sie Anrecht auf Mobilität. Entweder stellt man Ihnen die Kosten für einen Mietwagen zur Verfügung, oder Sie erhalten eine Nutzungsausfallentschädigung pro Tag. Die Wahl liegt bei Ihnen – was im konkreten Fall besser passt, können Sie entscheiden (siehe Kapitel 6 für Voraussetzungen).
- „Fiktive Abrechnung“ – Geld statt Reparatur: Sie dürfen sich den Schaden auch auszahlen lassen, anstatt zu reparieren. Das heißt, Sie können vom Versicherer den Geldbetrag verlangen, der für die Reparatur nötig wäre (netto, ohne Mehrwertsteuer), und dann frei darüber verfügen. Niemand kann Sie zwingen, das Fahrzeug tatsächlich reparieren zu lassen. Diese fiktive Abrechnung ist oft sinnvoll, wenn Sie den Wagen vielleicht verkaufen oder selbst günstiger instand setzen wollen. Näheres dazu in Kapitel 7.
Diese Rechte basieren auf Gesetzen und Rechtsprechung und stehen Ihnen zu – unabhängig davon, was die gegnerische Versicherung Ihnen vielleicht weismachen möchte. Oft kennen Unfallopfer nur wenige dieser Punkte; viele denken, sie bekommen nur die Reparatur bezahlt und vielleicht ein bisschen Schmerzensgeld. In Wirklichkeit gibt es bis zu 16 verschiedene Anspruchspositionen, die je nach Fall relevant werden. Seien Sie also informiert: Sie müssen sich nicht mit dem Erstbesten begnügen, sondern können den vollen Umfang Ihrer Rechte ausschöpfen.
Unabhängiger Gutachter und Anwalt – Wann und warum einschalten?
Eine der häufigsten Fragen nach einem unverschuldeten Unfall lautet: „Brauche ich einen Gutachter und einen Anwalt – oder geht das auch ohne?“ Die klare Antwort der Experten und Verbraucherschützer: Ja, Sie sollten bei Fremdverschulden immer einen unabhängigen Kfz-Sachverständigen und einen Rechtsanwalt hinzuziehen, außer vielleicht bei kleinsten Bagatellschäden. Warum? Hier die wichtigsten Gründe:
- Sicherung von Beweisen und vollständige Schadensermittlung (Gutachter): Ein unabhängiger Kfz-Gutachter begutachtet Ihr Fahrzeug neutral und detailliert. Er dokumentiert sämtliche Schäden, sichtbare und verborgene, kalkuliert die Reparaturkosten nach Herstellervorgaben, ermittelt den Wiederbeschaffungswert (Wert Ihres Fahrzeugs vor dem Unfall) und den merkantilen Minderwert (Wertverlust nach Reparatur). Außerdem schätzt er, wie lange die Reparatur dauern würde (wichtig für Mietwagen/Nutzungsausfall) und ob ein wirtschaftlicher Totalschaden vorliegt. Dieses Schadengutachten ist die Grundlage, um hinterher alle Ansprüche beziffern zu können. Ohne Gutachten laufen Sie Gefahr, dass Schäden übersehen oder zu niedrig angesetzt werden – insbesondere moderne Fahrzeuge haben Sensoren, Elektronik und Verkleidungsteile, deren Beschädigung Laien oft nicht erkennen. Die gegnerische Versicherung wird versuchen, den Schaden kleinzurechnen; ein eigenes Gutachten wirkt dem entgegen, denn es ist ein objektiver Nachweis. Wichtig: Beauftragen Sie den Gutachter selbst, sofort nach dem Unfall, und lassen Sie nicht etwa den Versicherer des Gegners einen Gutachter schicken. Ein von der Versicherung beauftragter Sachverständiger könnte tendenziell im Sinne des Zahlenden berichten, also den Schaden niedriger ansetzen. Ihr eigener Gutachter vertritt Ihre Interessen und liefert ein unabhängiges Ergebnis. Die Kosten für das Gutachten müssen Ihnen bei fremdverschuldetem Unfall erstattet werden – darum sollte der Gutachter auch die Rechnung direkt an die gegnerische Versicherung schicken.
- Durchsetzung Ihrer Ansprüche (Anwalt): Ein spezialisierter Rechtsanwalt für Verkehrsrecht nimmt Ihnen die Kommunikation mit der Versicherung ab und sorgt dafür, dass kein Posten vergessen wird. Versicherungen spekulieren darauf, dass Privatleute die Rechtslage nicht kennen und machen von sich aus oft nur begrenzte Angebote. Ihr Anwalt kennt alle Ansprüche – von der Kostenpauschale bis zum Haushaltsführungsschaden – und wird sie in angemessener Höhe geltend machen. Er weiß, wie man mit typischen Verzögerungstaktiken umgeht und wie lange die Versicherung Zeit hat, zu zahlen, bevor man Druck machen kann. Falls nötig, kann er auch Klage einreichen. Kurzum: Der Anwalt sorgt für Waffengleichheit. Während Sie sich um Ihre Genesung und Ersatzmobilität kümmern, übernimmt er den lästigen Papierkram und die Verhandlungen. Und das Beste: Bei klarem Fremdverschulden zahlt die gegnerische Versicherung seine Gebühren als Teil des Schadensersatzes. Für Sie ist die anwaltliche Hilfe also im Ergebnis kostenfrei. Zögern Sie deshalb nicht aus Angst vor Kosten.
Wann einschalten? Am besten so früh wie möglich. Idealerweise kontaktieren Sie noch vom Unfallort oder am gleichen Tag einen Gutachter und einen Anwalt. Viele Gutachter kommen zum Unfallwagen (auch zur Werkstatt oder zu Ihnen nach Hause) innerhalb kürzester Zeit, um den Schaden aufzunehmen. Anwälte können oft telefonisch eine Ersteinschätzung geben und sagen Ihnen, welche Infos sie benötigen. Je eher diese Profis im Boot sind, desto geringer die Gefahr, dass Fehler passieren oder die Versicherung Ihnen etwas „abluchst“. Sie müssen sich dann nicht mehr persönlich mit der gegnerischen Versicherung auseinandersetzen – das übernimmt der Anwalt für Sie. Auch die Schadenmeldung kann bereits durch den Anwalt erfolgen, was formell und inhaltlich sicherer ist.
Bagatellschäden: Bei sehr kleinen Schäden (z.B. ein minimaler Kratzer ohne Delle) unter ca. 750 € spricht man von einem Bagatellschaden. In solchen Fällen übernehmen Versicherungen die Gutachterkosten unter Umständen nicht, weil ein Kostenvoranschlag der Werkstatt genügt. Hier könnte man auf einen teuren Gutachter verzichten und nur eine Werkstattschätzung einholen. Aber Vorsicht: Als Laie unterschätzt man die Schadenhöhe leicht. Ein vermeintlicher Parkrempler kann durch versteckte Schäden (z.B. Sensoren) durchaus mehr als 750 € kosten. Daher im Zweifel lieber doch einen Gutachter fragen – viele Sachverständige sagen Ihnen ehrlich, wenn es ein Bagatellschaden ist und ein Gutachten nicht lohnt. Einen Anwalt können und sollten Sie hingegen auch bei Bagatellschäden einschalten, sofern der Fall klar fremdverschuldet ist. Die Gebühren eines Anwalts bei geringem Streitwert sind überschaubar, und auch diese trägt im Prinzip der Unfallgegner. Zudem hilft der Anwalt, selbst kleine Ansprüche (z.B. die Auslagenpauschale) durchzusetzen.
Zusammenfassung: Gutachter und Anwalt sind Ihre wichtigsten Verbündeten nach einem unverschuldeten Unfall. Sie sorgen dafür, dass der Schaden umfassend erfasst und reguliert wird. Zögern Sie nicht aus falsch verstandenem Vertrauen zur Versicherung oder aus Sparsamkeit – Ihnen entgehen sonst womöglich Hunderte oder Tausende Euro. Denken Sie daran: Die gegnerische Versicherung hat sofort Profis (Schadensregulierer, Juristen) auf ihrer Seite, die für die Versicherung arbeiten. Mit eigenem Gutachter und Anwalt sind Sie auf Augenhöhe. Und: Die Kosten tragen nicht Sie, sondern der Unfallverursacher bzw. dessen Versicherung. Dieses Recht sollten Sie konsequent nutzen.
Die Schadensregulierung Schritt für Schritt
Nachdem die Unfallstelle geräumt, alle wichtigen Beweise gesichert und Ihre Helfer (Gutachter/Anwalt) organisiert sind, beginnt der Prozess der Schadensregulierung. Das bedeutet: Die Formalitäten und Kommunikation mit den Versicherungen, die Bezifferung Ihrer Ansprüche und schließlich die Auszahlung bzw. Leistung der Entschädigungen. In diesem Kapitel erläutern wir, wie Sie den Schaden melden, wer zuständig ist und wie Sie mit der Versicherung kommunizieren sollten. Wichtig ist, dass Sie fristgerecht und vollständig vorgehen, um keine Ansprüche zu gefährden.
Schadenmeldung bei der Versicherung
Unfall der gegnerischen Versicherung melden: Als Geschädigter sind Sie dafür verantwortlich, den Schaden der Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers anzuzeigen. Die gegnerische Kfz-Haftpflicht ist der Versicherer, der letztlich für die Zahlung aufkommen muss. Oft fragt die Polizei vor Ort schon nach den Versicherungsdaten oder notiert sie im Protokoll. Falls nicht, können Sie den Unfallgegner direkt nach seiner Versicherung fragen (notieren Sie Versicherungsname und Nummer). Alternativ hilft der „Zentralruf der Autoversicherer“ unter 0800 250 2600: Dort können Sie unter Angabe des Kennzeichens des Gegners dessen Haftpflichtversicherer in Erfahrung bringen. Dieser Service ist kostenlos. Achtung: Der Zentralruf vermittelt auf Wunsch auch direkt den Schaden an den Versicherer – das sollten Sie vermeiden (siehe Kapitel 8 zu den Tricks). Am besten notieren Sie sich nur die Versicherungsinformationen.
Den Schaden können Sie dann schriftlich, telefonisch oder online beim Versicherer melden. Nennen Sie Unfalldatum, Ort, Beteiligte und eine kurze Schilderung des Hergangs aus Ihrer Sicht. Geben Sie keine Schuldanerkennung ab, bleiben Sie sachlich. Teilen Sie mit, welche Schäden entstanden sind (z.B. „Fahrzeugschaden vorne rechts, möglicherweise weitere verdeckte Schäden, personelle Verletzungen wie Schleudertrauma in Abklärung“). Wichtig: Schicken Sie alle relevanten Unterlagen mit bzw. reichen Sie sie zeitnah nach: das Unfallprotokoll oder Aktenzeichen der Polizei, den ausgefüllten Unfallbericht (falls vorhanden), Ihre Fotos, Zeugenkontakte, etc. Sobald das Gutachten vorliegt, geht es ebenfalls an die Versicherung. Wenn Sie bereits einen Anwalt haben, wird dieser die Schadenmeldung für Sie übernehmen und alle Unterlagen gebündelt einreichen – das ist der sicherste Weg.
Eigene Versicherung informieren: Auch wenn der Unfallgegner schuld ist, sollten Sie Ihre eigene Kfz-Versicherung über den Vorfall informieren. Viele Versicherungsverträge schreiben vor, dass jededer Unfall (auch ohne Eigenverschulden) unverzüglich gemeldet werden muss. Halten Sie daher die Frist ein (in der Regel innerhalb einer Woche). Diese Meldung dient vor allem dazu, Sie abzusichern, falls:
- Doch eine Teilschuld festgestellt wird (dann ist Ihre Versicherung vorbereitet) oder
- Der Gegner Fahrerflucht begangen hat und Sie ggf. Ihre Vollkasko in Anspruch nehmen müssen.
Melden Sie den Schaden Ihrer Versicherung formlos mit den Basisdaten, erwähnen Sie aber ruhig, dass Sie nach Ihrer Sicht keine Schuld trifft und die gegnerische Versicherung zuständig ist. Warum überhaupt eigene Versicherung informieren? Sollte später etwas Unvorhergesehenes passieren (z.B. der Gegner behauptet plötzlich, Sie seien schuld, oder er ist nicht versichert), ist Ihre Versicherung schon im Bilde und kann reagieren. Zudem wahren Sie damit die vertraglichen Obliegenheiten, sodass Ihr Versicherungsschutz nicht gefährdet ist.
Achtung: Wenn Sie vorhaben, Ihre Kaskoversicherung zu nutzen (z.B. weil der Unfallgegner unbekannt ist oder die Regulierung sich verzögert und Sie den Schaden erst mal über Vollkasko laufen lassen wollen), bedenken Sie, dass dies Auswirkungen auf Ihren Schadenfreiheitsrabatt haben kann. Ihre Prämie könnte also steigen. Lassen Sie sich im Zweifel beraten, ob es sinnvoll ist, die Kasko einzuschalten oder besser auf die gegnerische Regulierung zu warten. Manchmal übernimmt die eigene Versicherung vorläufig den Schaden und holt sich das Geld von der gegnerischen zurück (Stichwort „Regress“), was für Sie dann prämienneutral bleibt – aber versprechen kann man das nicht ohne individuelle Klärung.
Fristen: Für die Meldung des Schadens gilt grundsätzlich „unverzüglich“ (§ 7.1 AKB – Allgemeine Bedingungen für Kfz-Versicherung), also ohne schuldhaftes Zögern. Praktisch heißt das innerhalb von 1 Woche sollte die Meldung raus sein. Bei der gegnerischen Versicherung gibt es keine starre gesetzliche Frist, aber: Warten Sie nicht zu lange! Spätestens innerhalb von 2 Wochen nach Unfall sollte die Schadenanzeige dort vorliegen. Sonst riskieren Sie, dass man Ihnen eine Mitschuld an einer Verzögerung unterstellt. Gerade wenn Sie einen Anwalt einschalten, wird dieser die Meldung in der Regel zügig veranlassen.
Kommunikation mit der gegnerischen Versicherung (Do’s & Don’ts)
Sobald die gegnerische Versicherung vom Unfall erfährt, wird sie Kontakt mit Ihnen aufnehmen – manchmal schneller, als Ihnen lieb ist. Viele Geschädigte wundern sich, wenn plötzlich das Telefon klingelt und ein freundlicher „Schadenmanager“ der gegnerischen Versicherung sich erkundigt, wie es Ihnen geht und Details zum Unfall erfragen will. Vorsicht: Diese Freundlichkeit hat ein Ziel: Informationen sammeln, die später gegen Sie verwendet werden können. Deshalb ist es enorm wichtig, zu wissen, wie weit Ihre Pflichten zur Mitwirkung gehen – und wo Sie besser Schweigen bzw. auf schriftliche Kommunikation bestehen.
Was darf die gegnerische Versicherung von Ihnen verlangen? Grundsätzlich nur das, was zur Klärung der Schadensfrage notwendig ist. Dazu gehören:
- Angaben zu Ihrer Person und Erreichbarkeit, Bankverbindung (für die Schadenszahlung).
- Schilderung des Unfallhergangs aus Ihrer Sicht. Idealerweise übermitteln Sie das schriftlich, z.B. in Form des Unfallberichts oder eines Schreibens Ihres Anwalts.
- Einsicht in das Gutachten Ihres Sachverständigen, denn darauf basieren Ihre Forderungen.
- Belege für konkrete Kosten: z.B. die Rechnung der Werkstatt, des Mietwagens, Quittungen über Auslagen.
Mehr nicht! Unzulässig sind insbesondere:
- Verlangen nach langen mündlichen Schilderungen am Telefon oder gar einem persönlichen Treffen, wo man Sie aushorchen kann.
- Druck, etwas zu unterschreiben, z.B. ein Schuldanerkenntnis oder einen Vergleich, ohne dass Sie beraten sind. Unterschreiben Sie nichts dergleichen!
- Fragen nach medizinischen Details, die mit dem Unfall nichts zu tun haben (Ihre Krankenvorgeschichte geht den Kfz-Versicherer nichts an, außer die konkrete Verletzung durch den Unfall).
- Generell jede Forderung, die Ihnen komisch vorkommt oder über das Notwendige hinausgeht.
Tipp: Fühlen Sie sich unsicher, leiten Sie alle Kommunikation an Ihren Anwalt weiter. Sie müssen nicht persönlich mit der Versicherung sprechen. Es steht Ihnen frei zu sagen: „Bitte wenden Sie sich an meinen Anwalt, ich lasse alles darüber laufen.“ Tatsächlich dürfen Sie jeglichen direkten Kontakt ablehnen. Das ist kein unkooperatives Verhalten, sondern Ihr gutes Recht. Manche Versicherer versuchen trotzdem, direkten Kontakt zu bekommen – aus strategischen Gründen.
Telefonanrufe der Versicherung: Wie erwähnt, ist es üblich, dass Schadenregulierer anrufen. Sie sind nicht verpflichtet, mit ihnen zu telefonieren! Am Telefon sagt man leicht mal etwas Ungenaues oder verplappert sich. Beispiele: „Vielleicht war ich ja doch etwas schnell…“ – solche unbedachten Aussagen können später im Protokoll landen und Ihnen eine Teilschuld einbringen. Am Telefon haben Sie keine Beweisbarkeit, was wirklich gesagt wurde. Mündliche Absprachen sind im Zweifel nichts wert. Daher unser Rat: Gehen Sie nicht oder nur einmal ans Telefon, hören Sie sich an, was man will, und dann bitten Sie höflich darum, alles Weitere schriftlich zu klären oder über den Anwalt laufen zu lassen. Sie können sich z.B. bedanken für den Anruf und sagen: „Ich werde den Fall meinem Anwalt übergeben, bitte haben Sie Verständnis, dass ich das darüber regeln lasse.“ Danach: Notieren Sie sich Datum, Uhrzeit und Inhalt des Anrufs zur eigenen Dokumentation.
Schriftliche Kommunikation bevorzugen: Per Brief oder E-Mail können Sie Aussagen kontrollieren, Rücksprache mit dem Anwalt halten und haben einen Nachweis über alles, was besprochen wurde. Lassen Sie sich nicht auf schnelle Telefon-„Deals“ ein wie „Wir überweisen Ihnen schon mal 500 Euro, dann sind alle Ansprüche abgegolten“ – so etwas gehört geprüft. Bestehen Sie auf Schriftform für Angebote, Entscheidungen etc.
Zusammengefasst: Halten Sie die Zügel in der Hand. Geben Sie nur die notwendigen Infos preis, möglichst schriftlich, und lassen Sie sich nicht aushorchen. Sie sind kein Bittsteller, sondern Anspruchsteller. Wenn Sie unsicher sind, soll der Anwalt alles für Sie regeln – genau dafür ist er da, und genau deshalb zahlt die Versicherung auch seine Kosten. Die gegnerische Versicherung hat ein Ziel: möglichst wenig zahlen. Alles, was Sie sagen, könnte gegen Sie verwendet werden – denken Sie an diesen fast sprichwörtlichen Satz. Also lieber wenig sagen, und wenn, dann überlegt und idealerweise mit fachkundiger Unterstützung.
Alle Schadenersatzansprüche im Überblick – die 16 Positionen
Viele Unfallopfer kennen nur ein paar offensichtliche Ansprüche, etwa die Reparatur ihres Autos und vielleicht noch Schmerzensgeld, wenn sie verletzt wurden. Tatsächlich jedoch können je nach Unfallgeschehen bis zu 16 verschiedene Schadenspositionen zusammenkommen. In diesem Kapitel geben wir Ihnen einen vollständigen Überblick. Sie werden sehen: Schadenersatz umfasst weit mehr als die Werkstattrechnung. Wichtig ist, dass jeder Posten belegbar sein muss (Gutachten, Rechnungen, Quittungen, Atteste) – dann muss die Versicherung des Unfallgegners diese auch ersetzen. Hier die 16 möglichen Anspruchspositionen im Einzelnen:
- Reparaturkosten am Fahrzeug: Das sind die Kosten, um Ihr beschädigtes Fahrzeug instand zu setzen. Grundlage ist das Gutachten oder der Kostenvoranschlag einer Werkstatt. Dazu zählen Material-, Lohn- und Lackierkosten, ggf. auch der Aufschlag für Wertminderung bei Ersatzteilen usw. Wichtig: Sie haben Anspruch auf fachgerechte Reparatur nach Herstellervorgaben, in einer Werkstatt Ihrer Wahl (siehe Kapitel 3). Die Versicherung darf nicht billigere Alternativen diktieren. Mehrwertsteuer wird Ihnen allerdings nur erstattet, wenn Sie tatsächlich reparieren lassen und sie anfällt (bei fiktiver Abrechnung ohne Reparatur gibt es netto). Die Reparaturkosten bilden oft den größten Posten. Wenn sie den Fahrzeugwert übersteigen, handelt es sich um einen Totalschaden – dazu siehe Kapitel 7 (130%-Regel etc.).
- Wiederbeschaffungswert: Ist Ihr Fahrzeug so schwer beschädigt, dass eine Reparatur unwirtschaftlich wäre (wirtschaftlicher Totalschaden), können Sie statt der Reparaturkosten den Wiederbeschaffungswert (WBW) verlangen. Das ist der Betrag, den Sie benötigen, um sich ein gleichwertiges Fahrzeug wieder zu beschaffen. Er wird vom Gutachter ermittelt und entspricht dem Marktwert Ihres Wagens kurz vor dem Unfall. Beispiel: Ihr Auto war vor dem Unfall noch etwa 8.000 € wert – das ist dann der WBW. Die Versicherung zahlt Ihnen diesen Betrag (abzgl. Restwert, siehe Punkt 3), damit Sie sich ein ähnliches Auto kaufen können.
- Restwert des Fahrzeugs: Bleibt Ihr kaputtes Auto übrig – insbesondere bei Totalschaden – hat es meist noch einen Restwert. Das ist der Betrag, den ein Händler oder Verwerter Ihnen noch für das Unfallfahrzeug zahlen würde (entweder zum Ausschlachten oder Instandsetzen). Der Restwert wird vom Gutachter anhand von regionalen Marktwerten oder Restwertbörsen ermittelt. Wenn Sie den Schaden fiktiv abrechnen (also sich auszahlen lassen), zieht die Versicherung den Restwert vom Wiederbeschaffungswert ab, denn Sie sollen ja am Ende nicht mehr Geld haben als vor dem Unfall. Beispiel: Wiederbeschaffungswert 7.000 €, Restwert 2.500 € – Sie erhalten 7.000 – 2.500 = 4.500 € ausgezahlt, und können das kaputte Fahrzeug behalten. Wichtig: Sie müssen nicht das erstbeste oder höchste Restwertangebot nehmen, das die Versicherung evtl. vorlegt. Es kommt oft vor, dass Versicherer überregional sehr hohe Angebote einholen, um ihre Zahlung zu drücken. Rechtlich dürfen Sie den vom Gutachter ermittelten Restwert zugrunde legen, solange Sie das Fahrzeug tatsächlich behalten möchten. Verkaufen Sie es hingegen, sollten Sie natürlich den besten Preis erzielen und dieser wird dann berücksichtigt.
- Wertminderung (merkantiler Minderwert): Selbst nach fachgerechter Reparatur kann Ihr Fahrzeug an Wert verlieren, weil es nun einen Unfallvorschaden hat. Dieser Minderwert ist beim späteren Verkauf spürbar: Viele Käufer zahlen für ein instandgesetztes Unfallfahrzeug weniger als für ein unfallfreies. Diesen „merkantilen Minderwert“ können Sie ersetzt verlangen. Der Gutachter beziffert ihn im Gutachten. Er hängt z.B. vom Alter und Zustand des Autos und der Schadenshöhe ab. Typischerweise wird bei jüngeren Fahrzeugen ein gewisser Prozentsatz des WBW als Wertminderung angesetzt, sofern der Schaden nicht nur Bagatelle ist. Beispiel: Ihr 3 Jahre altes Auto (50.000 km) war 20.000 € wert; nach einer größeren Reparatur (10.000 € Kosten) ermittelt der Gutachter eine Wertminderung von 1.500 €. Diesen Betrag muss die Versicherung zahlen, damit Ihr Vermögensnachteil ausgeglichen ist. (Hinweis: Bei sehr alten Autos, sehr geringer Schadenhöhe oder rein kosmetischen Schäden gibt es oft keine Wertminderung. Auch bei Bagatellschäden unter ca. 750 € wird keine Wertminderung angesetzt)
- Mietwagenkosten: Wenn Sie durch den Unfall kein fahrbereites Auto mehr haben, dürfen Sie sich für die Reparaturdauer oder bei Totalschaden für die Beschaffungsdauer einen Mietwagen nehmen. Die Versicherung des Gegners muss die Kosten dafür übernehmen– allerdings nur für einen Klasse adäquaten Wagen (vergleichbare Fahrzeugklasse wie Ihr eigener) und nur solange wie nötig. Was heißt nötig? Die Reparaturdauer plus ggf. ein paar Tage für Gutachter oder Ersatzteilbestellung; bei Totalschaden die Zeit, bis Sie ein neues Auto beschafft haben. Wichtig: Sie haben eine Schadensminderungspflicht. Das bedeutet, Sie sollten keinen Luxusmietwagen nehmen, der teurer ist als nötig, und auch nicht länger als erforderlich behalten. Außerdem ziehen Versicherungen oft einen „Eigenersparnis“-Abzug ab (ca. 10%), weil Sie Ihr eigenes Auto ja während der Reparatur nicht abnutzen. Achten Sie darauf, dass Sie keinen überteuerten Tarif wählen – am besten Rücksprache mit dem Anwalt, der kennt die angemessenen Pauschalen. Wenn Sie täglich unter 20 km fahren oder kein absolutes Bedürfnis haben, kann die Versicherung argumentieren, ein Mietwagen sei nicht „erforderlich“ gewesen. Lassen Sie sich dazu beraten, ob in Ihrem Fall ein Mietwagen okay ist. Im Zweifel: Wenn Sie darauf angewiesen sind (Beruf, Familie, weite Wege), steht er Ihnen zu.
- Nutzungsausfallentschädigung: Anstatt eines Mietwagens können Sie Nutzungsausfall geltend machen. Das ist eine tägliche Pauschale, die Ihnen dafür gezahlt wird, dass Sie Ihr eigenes Auto vorübergehend nicht nutzen können. Die Höhe dieser Pauschale hängt vom Fahrzeugtyp ab (es gibt Tabellen, z.B. nach „Schwacke“, wo Autos in Gruppen eingeteilt sind – ein Kleinwagen bringt vielleicht 30 € pro Tag, eine Oberklasse-Limousine 100 €+ pro Tag). Nutzungsausfall gibt es für die gleiche Dauer, die eine Reparatur oder Ersatzbeschaffung dauern würde. Sie können entweder Mietwagen oder Nutzungsausfall geltend machen, nicht beides gleichzeitig. Tipp: Wenn die Schuldfrage nicht 100% geklärt ist oder Sie eine Teilschuld befürchten, kann Nutzungsausfall klüger sein als Mietwagen: Denn sollten Sie am Ende z.B. 25% Mitschuld tragen, würden Sie 25% der Mietwagenkosten selbst bezahlen müssen – das kann teuer sein, während der Nutzungsausfall ein reiner Anspruch ist, der nur ggf. gekürzt wird.
- Abschleppkosten und Bergung: Nach einem Unfall muss ein kaputtes Fahrzeug oft abgeschleppt werden – von der Unfallstelle zur Werkstatt, zum Gutachter oder nach Hause. Abschleppkosten gehören zum Schaden und sind erstattungsfähig. Voraussetzung: Das Abschleppen war notwendig (z.B. Auto war nicht mehr fahrbereit oder es wäre unzumutbar gewesen, es stehen zu lassen). Außerdem sollten Sie Ihrer Pflicht zur Schadenminderung nachkommen: also nicht den teuersten Abschleppdienst aus 50 km Entfernung beauftragen, sondern einen naheliegenden Dienst, i.d.R. den, der von der Polizei gerufen wird oder den nächstgelegenen Betrieb. Müssen Teile von der Fahrbahn geborgen oder Ölspuren beseitigt werden, übernimmt das meist die Polizei/Feuerwehr, aber falls Sie hierfür eine Rechnung erhalten, gehört auch das zum Schaden. Standkosten: Wenn Ihr Auto in der Werkstatt oder beim Abschleppdienst erst mal steht, bis die Regulierung geklärt ist, können Standgebühren anfallen (manche Werkstätten berechnen ab Tag X Standgeld für das Abstellen des Unfallwagens). Auch diese Kosten müssen ersetzt werden – jedoch sollten Sie das Auto nicht wochenlang unnötig herumstehen lassen, sonst kommt wieder die Schadenminderungspflicht ins Spiel. Sobald klar ist, was mit dem Fahrzeug passiert (Reparatur oder Verkauf), sollte es weiter transportiert oder verwertet werden.
- Kosten für Gutachter und ggf. technische Untersuchungen: Wie schon betont, haben Sie Anspruch auf einen freien Gutachter, und dessen Kosten zahlt der Gegner. Das Gutachten rechnet der Sachverständige meist direkt mit der Versicherung ab; falls nicht, legen Sie es aus und fordern Erstattung. In seltenen Fällen könnten zusätzliche technische Gutachten nötig sein (z.B. zur Unfallursache, Bremsversagen etc.) – bei unverschuldetem Unfall würde auch das übernommen, wenn es zur Beweisführung dient. Gutachterkosten sind also Teil des Schadensersatzes. Beachten Sie: Bei sehr geringem Schaden (Bagatellgrenze, ca. 750 €) kann die Versicherung ein Gutachten für überflüssig erklären und stattdessen nur die Kosten eines Kostenvoranschlags erstatten. Diese Grenze ist aber nicht starr – und wenn Sie unsicher waren, ist es im Regelfall trotzdem okay, dass Sie einen Gutachter bestellt haben, solange der Schaden nicht offensichtlich minimal war.
- Anwaltskosten: Entschließen Sie sich – wie empfohlen – einen Anwalt einzuschalten, so muss die Haftpflichtversicherung des Unfallgegners dessen Kosten tragen (bei voller Haftung des Gegners). Das betrifft die gesetzlichen Rechtsanwaltsgebühren nach RVG (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) basierend auf dem sogenannten Streitwert (= Summe Ihrer Forderungen). Auch die Auslagenpauschale des Anwalts und eventuelle Gerichtskosten im Prozess (wenn es dazu käme und Sie obsiegen) gehören dazu. Für Sie bedeutet das: Der Anwalt kostet nichts extra, es sei denn, es stellt sich wider Erwarten heraus, dass Sie doch (mit)schuldig sind – dann könnte es abweichen. Aber im klaren Fremdverschuldensfall: Anwalts- und Gerichtskosten = Schadensposition des Gegners. (Falls Sie eine Rechtsschutzversicherung haben, können Sie diese natürlich auch einschalten, die würde dann in Vorleistung gehen, aber letztlich holt auch sie sich das Geld vom Gegner zurück.)
- Unkostenpauschale (Telefon/Porto): Die sogenannten “Auslagen” oder Unkosten des Geschädigten darf man ebenfalls abrechnen. Weil Sie durch den Unfall z.B. Telefonate führen, Briefe schreiben, Kopien anfertigen, eventuell Fahrten machen müssen (zur Werkstatt, zum Anwalt), erkennt die Rechtsprechung einen Pauschalbetrag an – typischerweise 20 bis 30 Euro. Das nennt man Kosten- oder Unkostenpauschale. Üblicherweise werden 25 € geltend gemacht, und die meisten Versicherer zahlen das auch anstandslos, da es üblich ist. Sie brauchen dafür keine Einzelbelege für jedes Porto, es genügt die pauschale Forderung.
- Schmerzensgeld: Wurden Sie beim Unfall verletzt, steht Ihnen Schmerzensgeld. Dieser Anspruch soll Ihre körperlichen und seelischen Schmerzen ausgleichen. Typische Fälle: Schleudertrauma, Prellungen, Schnittwunden, Knochenbrüche, aber auch psychische Folgen wie ein Trauma. Die Höhe des Schmerzensgeldes bemisst sich nach Art und Schwere der Verletzung, Dauer der Schmerzen/Behandlung, evtl. bleibenden Schäden. Es gibt in Deutschland keine festen Beträge, aber Vergleichswerte in Schmerzensgeldtabellen. Zum Beispiel können für ein einfaches Schleudertrauma ein paar hundert Euro angemessen sein, für einen komplizierten Beinbruch einige tausend, für sehr schwere dauerhafte Beeinträchtigungen auch fünf- oder sechsstellige Beträge. Wichtig: Sie müssen nachweisen, dass Ihre Verletzungen vom Unfall stammen. Deshalb: sofort zum Arzt (siehe Kapitel 2) und alle Befunde sichern. Oft wird Schmerzensgeld in einem einmaligen Betrag ausgezahlt, manchmal versucht die Versicherung wenig anzubieten – hier verhandelt der Anwalt für Sie. Bei schweren Personenschäden kann es auch in eine Rente übergehen, aber das sprengt hier den Rahmen.
- Heilbehandlungskosten: Alle medizinischen Kosten infolge des Unfalls müssen ersetzt werden– soweit sie nicht sowieso ein anderer Kostenträger übernimmt. In der Regel läuft Ihre Behandlung ja über die Krankenversicherung. Diese wird aber im Hintergrund die gegnerische Kfz-Versicherung in Regress nehmen. Praktisch bekommen Sie also selten eine Rechnung. Was Sie aber haben könnten: Zuzahlungsbelege (z.B. Rezeptgebühren, Physiotherapie auf Privatrezept, spezielle Hilfsmittel wie Bandagen, die Sie selbst bezahlt haben). Bewahren Sie alle Quittungen dafür auf – Sie können die Eigenanteile erstattet verlangen. Auch Taxifahrten oder Fahrten mit dem eigenen Auto zum Arzt/Krankenhaus können abgerechnet werden (ggf. als Teil der „Fahrtkosten“, siehe nächster Punkt). Sollte eine Behandlung nicht von der Krankenkasse abgedeckt sein, klären Sie mit dem Anwalt, ob die Kfz-Versicherung die Kosten direkt tragen muss.
- Fahrtkosten / Reisekosten: Im Zusammenhang mit dem Unfall können Fahrtkosten entstehen, z.B.
- Fahrten zum Arzt oder zur Physiotherapie,
- Fahrten zur Werkstatt, zum Gutachter, zum Anwalt oder zur Versicherung.
Auch Taxi- oder ÖPNV-Kosten fallen darunter. Solche notwendigen Fahrten können Sie erstattet verlangen, meist wird eine Kilometerpauschale angesetzt (oft €0,30 pro km, analog zu Zeugenentschädigungen). Notieren Sie sich die Fahrten (Datum, Kilometer) oder bewahren Sie Tickets/Belege auf. Bei längeren Reisen (etwa Sie mussten Ihr Auto aus dem Urlaubsort überführen lassen oder ähnliches) können auch Übernachtungskosten etc. gelten – das wäre dann individuell zu betrachten. In der Regel bewegt es sich im kleinen Rahmen für Arztbesuche. Dennoch: Auch Kleinvieh macht Mist, und es gehört Ihnen erstattet.
- Haushaltsführungsschaden / Ersatzhaushaltshilfe: Wenn Sie durch Verletzungen so eingeschränkt sind, dass Sie Ihren Haushalt nicht wie gewohnt führen können (z.B. kochen, putzen, einkaufen, Kinder betreuen), entsteht ein Haushaltsführungsschaden. Sie dürfen entweder eine Haushaltshilfe engagieren und die Kosten dafür geltend machen oder – auch wenn ein Familienmitglied unentgeltlich hilft – einen fiktiven Geldwert verlangen. Die Berechnung richtet sich nach Ihrem Haushalt (Personenanzahl, qm, etc.) und dem Grad Ihrer Einschränkung. Dieser Posten wird oft übersehen, ist aber bei mittleren und schweren Verletzungen wichtig. Beispiel: Sie sind nach dem Unfall 4 Wochen auf Gehhilfen und können nicht staubsaugen oder schwer heben. Ihr Partner übernimmt alles – dann kann man z.B. 4 Wochen * x Stunden * €10/Stunde ansetzen und fordern. Oder Sie stellen jemanden ein, dann die Rechnung. Die gegnerische Versicherung muss diese Kosten tragen, denn ohne Unfall hätten Sie Ihren Haushalt selbst geschafft.
- Verdienstausfall: Falls Sie aufgrund der Unfallverletzungen arbeitsunfähig werden und Ihr Einkommen dadurch leidet, steht Ihnen Ersatz zu. Bei Angestellten zahlt der Arbeitgeber meist bis zu 6 Wochen normal weiter (Lohnfortzahlung). Danach erhalten Sie von der Krankenkasse Krankengeld (~70% des Nettos). Die Differenz zu 100% kann als Verdienstausfall von der gegnerischen Versicherung verlangt werden. Bei längerer Arbeitsunfähigkeit summiert sich das. Bei Selbstständigen wird es komplexer: Hier muss man den entgangenen Gewinn nachweisen (z.B. durch BWA, Vergleichsumsätze) – auch das ist ersatzfähig. Wichtig ist, dass der Arbeitsausfall unfallbedingt sein muss (durch Atteste belegbar). Wenn Sie z.B. ohnehin krankgeschrieben gewesen wären aus anderen Gründen, dann nicht. Dokumentieren Sie die Zeiten der AU (Arbeitsunfähigkeit) und Einkommenseinbußen. Bei bleibender Erwerbsminderung können sogar Rentenansprüche entstehen, aber das ist ein Spezialfall. In den meisten Fällen geht es um ein paar Wochen Gehaltseinbuße. Rechnen Sie das nicht selbst klein, sondern lassen Sie Ihren Anwalt das mit Lohnnachweisen etc. beziffern.
- Sonstige Sachschäden / Kosten: Zuletzt gibt es diverse kleinere Posten, die aber erwähnt sein sollen. Dazu zählen:
- Persönliche Gegenstände, die im Unfall kaputtgingen: z.B. Brille, Handy, Laptop, Kleidung, Kindersitz etc. Alles, was mitgeführt wurde und durch den Unfall beschädigt wurde, ist Teil des Schadensersatzes. Voraussetzung ist, dass es plausibel im Auto war und beschädigt wurde (und nicht ohnehin alt/defekt war). Sie müssen im Zweifel nachweisen, dass der Gegenstand beim Unfall zu Bruch ging – Fotos, Zeugenaussagen helfen. Beispiel: Ihre Brille wurde durch den Aufprall zerstört – die gegnerische Versicherung muss Ihnen eine gleichwertige neue Brille bezahlen.
- Kosten für Fahrzeugan- und -abmeldung: Bei einem Totalschaden kaufen Sie ggf. ein Ersatzfahrzeug. Die Zulassungsgebühren für das neue Auto und die Abmeldung des alten sind erstattungsfähig. Heben Sie Quittungen der Zulassungsstelle auf. Auch Kennzeichen-Prägungskosten etc. gehören dazu. Sie können sogar einen Zulassungsdienst nutzen und die Kosten geltend machen.
- Entgangener Urlaub: Hatten Sie wegen des Unfalls einen Urlaub abbrechen oder konnten geplante Urlaubstage nicht wie gewünscht nutzen (z.B. wegen Verletzung im Bett statt am Strand), kann theoretisch auch dieser immaterielle Schaden berücksichtigt werden. Er wird allerdings meist im Schmerzensgeld mit berücksichtigt anstatt separat ausgewiesen. Aber es kann erwähnt werden, falls z.B. Flüge verfallen sind, das wäre dann wieder ein konkreter finanzieller Schaden.
- Sonstiges: In manchen Fällen entstehen noch besondere Schäden wie Gutachterkosten für Wertgutachten (z.B. bei Oldtimer), Kosten für Rechtsberatung im Ausland etc. Ein spezieller Fall ist auch der „Gewinnverlust“ bei entgangenem Urlaub oder entgangener Freizeit, was aber oft ins Schmerzensgeld einfließt. Auch Mietausfall bei Taxiunternehmen (wenn das Taxi kaputt ist) wäre ein Anspruch. Dies betrifft aber Sonderfälle.
Wie Sie sehen, ist die Liste lang. Kein Unfall hat alle 16 Posten zugleich, aber es lohnt sich, jeden einzelnen durchzugehen und zu prüfen: Trifft das bei mir zu? Ihr Anwalt wird das automatisch machen, doch wenn Sie ohne Anwalt handeln, sollten Sie selbst diese Checkliste nutzen, damit nichts unter den Tisch fällt. Denken Sie daran: Was Sie nicht wissen oder fordern, das spart die Versicherung ein. Seien Sie daher gründlich. Lieber einen Posten extra angeben – die Versicherung wird schon begründet ablehnen, wenn er wirklich nicht passt – als etwas vergessen.
Reparatur, Totalschaden oder „fiktive Abrechnung“ – wie abrechnen? (inkl. 130%-Regel)
Nachdem alle Schäden festgestellt sind, stellt sich die praktische Frage: Was tun mit meinem beschädigten Fahrzeug? Lassen Sie es reparieren? Verkaufen Sie es und kaufen ein neues? Oder behalten Sie es unrepariert? Die Entscheidung hängt einerseits von Ihren persönlichen Vorlieben ab (emotionale Bindung, Aufwand, Mobilitätsbedarf), andererseits von wirtschaftlichen Faktoren (Kosten vs. Wert). In diesem Kapitel erläutern wir die verschiedenen Abrechnungsarten – insbesondere die Reparatur vs. Abrechnung auf Gutachtenbasis – und erklären die wichtige 130%-Regel bei Totalschäden. So können Sie eine informierte Entscheidung treffen, die sowohl Herz als auch Verstand berücksichtigt.
Reparatur in Werkstatt („Naturalrestitution“): Der Normalfall ist, dass Sie Ihr Auto in einer Werkstatt reparieren lassen. Sie wählen die Werkstatt (z.B. Markenwerkstatt oder Karosserie-Fachbetrieb). Dort wird auf Basis des Gutachtens oder eines eigenen Kostenvoranschlags repariert. Die Werkstatt rechnet meist direkt mit der Versicherung ab, oder Sie zahlen und reichen die Rechnung ein. Vorteil: Ihr Auto ist hinterher wieder ganz, und Sie mussten nicht in Vorkasse (wenn Direktabrechnung erfolgte). Nachteil: Sie sind für einige Zeit ohne Auto (Mietwagen/Nutzungsausfall erhalten Sie ja dafür). Für viele ist die Reparatur der beste Weg, vor allem wenn das Fahrzeug noch relativ neu oder wertvoll ist.
Fiktive Abrechnung (Geld auszahlen lassen): Sie haben immer das Recht, statt einer Reparatur den Geldbetrag zu verlangen, der für die Reparatur nötig wäre. Das nennt man „Abrechnung auf Gutachtenbasis“ oder fiktive Abrechnung. In diesem Fall zahlt die Versicherung Ihnen z.B. laut Gutachten 5.000 € Reparaturkosten netto aus (ohne MwSt., da keine tatsächliche Reparatur), und Sie können damit machen, was Sie wollen. Sie dürfen das Auto unrepariert weiterfahren (wenn verkehrssicher) oder billig privat reparieren oder verkaufen. Warum fiktiv abrechnen? Beispielsweise: Ihr Auto ist alt und ein wirtschaftlicher Totalschaden, Sie bekommen 2.000 € WBW – Sie könnten das Auto aber für 1.000 € notdürftig reparieren und weiter nutzen, dann machen Sie finanziell Plus. Oder Sie sind handwerklich geschickt und beheben den Schaden selbst günstiger. Oder Sie brauchen kein Auto mehr und behalten das Geld. Achtung: Bei fiktiver Abrechnung gibt es keine Mehrwertsteuer, da diese nur erstattet wird, wenn sie wirklich anfällt. Außerdem können bestimmte Positionen wegfallen, z.B. bekommen Sie Nutzungsausfall nur für die geschätzte Reparaturdauer, wenn Sie das Auto in dieser Zeit tatsächlich nicht genutzt haben (bei fiktiver Abrechnung tricky nachzuweisen). Generell aber ist fiktive Abrechnung ein legitimer Weg. Die Versicherung zahlt dann den Netto-Reparaturbetrag bzw. bis zum WBW bei Totalschaden.
Wirtschaftlicher Totalschaden: Von einem wirtschaftlichen Totalschaden spricht man, wenn die Reparaturkosten den Wiederbeschaffungswert (WBW) übersteigen. Beispiel: Auto wert vor Unfall 5.000 €, Reparaturkosten 7.000 € – das ist weit über dem Wert, Reparatur wäre unwirtschaftlich. In so einem Fall zahlt die Versicherung im Prinzip den WBW abzüglich Restwert (siehe Kapitel 6, Punkte 2 und 3). Sie haben dann das Geld, um sich ein ähnliches Fahrzeug anzuschaffen. Wichtig: Das ist kein technischer Totalschaden (der läge vor, wenn das Auto gar nicht repariert werden kann). Theoretisch könnten Sie es reparieren lassen, aber es wäre eben teurer als ein Ersatzwagen – das macht ökonomisch keinen Sinn. Allerdings gibt es eine Ausnahme für Leute, die ihr Auto unbedingt behalten wollen: die 130%-Regel.
Die 130%-Regel (Liebhaberreparatur): Diese besagt vereinfacht: Sie dürfen Ihr Fahrzeug trotz wirtschaftlichem Totalschaden reparieren lassen, wenn die Reparaturkosten nicht mehr als 130% des Wiederbeschaffungswertes betragen. Die Versicherung muss dann ausnahmsweise die höheren Reparaturkosten zahlen – allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen:
- Die Reparaturkosten dürfen max. 130% des Fahrzeugwerts betragen.
- Die Reparatur muss fachgerecht und vollständig erfolgen (nachweisbar durch Werkstattrechnung).
- Sie müssen das Fahrzeug anschließend mindestens 6 Monate weiter nutzen.
Erfüllen Sie diese Bedingungen, zahlt die Versicherung tatsächlich mehr als der Wagen vorher wert war. Beispiel: Ihr Auto war 5.000 € wert. 130% davon sind 6.500 €. Die Reparatur kostet laut Gutachten 6.200 €. Sie lassen reparieren, fahren mindestens 6 Monate weiter – die Versicherung übernimmt die 6.200 € (anstatt Sie auf 5.000 € zu begrenzen). Warum gibt es diese Regel? Sie kommt aus Gerichtsurteilen (BGH-Rechtsprechung) und soll dem Interesse des Geschädigten Rechnung tragen, sein vertrautes Fahrzeug behalten zu dürfen, auch wenn es rein rechnerisch unvernünftig erscheint. Es ist also eine Art Kulanz, die jedoch klare Grenzen hat (max 130%, Reparatur muss nachweislich komplett sein). Achtung: Wenn Sie teilreparieren oder schlampig reparieren, verfällt der Anspruch – dann bekommen Sie doch nur den WBW. Also wirklich nur nutzen, wenn Sie ernsthaft komplett instand setzen lassen. Und halten Sie die 6-Monats-Frist ein (manchmal wird eine eidesstattliche Versicherung verlangt, dass Sie das Fahrzeug noch besitzen).
Was tun bei Totalschaden? Stehen Sie vor der Entscheidung Reparatur vs. Geldnehmen, überlegen Sie: Wie alt ist das Auto? Hängen Sie daran? Gibt es vergleichbare auf dem Markt? Manchmal lohnt es sich emotional oder weil das Auto beispielsweise gerade neue Teile hatte, es zu behalten. Ein unabhängiger Gutachter kann Ihnen hierbei schon helfen, denn er liefert die Zahlen (WBW, Restwert, Reparaturkosten), auf deren Basis Sie entscheiden können. Unser Rat: Handeln Sie nicht vorschnell. Überstürzen Sie keinen Verkauf an den Nächstbesten. Schlafen Sie eine Nacht drüber, besprechen Sie mit Fachleuten (Gutachter, Anwalt) Ihre Optionen. Lassen Sie auch Ihr Bauchgefühl zu: Manche möchten ihren treuen Wagen nicht aufgeben, andere sagen „lieber was Neues“. Finanziell sollten Sie am Ende nicht schlechter dastehen, egal was Sie tun – dafür sorgen ja Ihre Ansprüche.
Reparatur durch Versicherung (Schadenmanagement): Manchmal bietet die gegnerische Versicherung an: „Wir organisieren die Reparatur für Sie, kostenloser Abholservice, Ersatzwagen inklusive.“ Dieses sogenannte Schadenmanagement klingt verlockend, aber Vorsicht (siehe Kapitel 8 für die Fallstricke)! Wenn Sie darauf eingehen, lassen Sie die Versicherung die Kontrolle übernehmen – oft verbunden mit Verzicht auf bestimmte Rechte (z.B. eigene Werkstattwahl, Wertminderungsausgleich). Unser Tipp: Nutzen Sie lieber Ihre Rechte und entscheiden selbst über die Reparatur. Nur wenn Sie absolut kein Interesse an Details haben und Ihnen alles egal ist, könnte man es in Betracht ziehen – doch in der Regel steckt dahinter Sparabsicht der Versicherung zu Ihrem Nachteil.
Fazit dieses Kapitels: Ob Sie reparieren oder abrechnen lassen, hängt von Zahlen und persönlichen Vorlieben ab. Dank der 130%-Regel haben Sie sogar Spielraum, ein geliebtes Fahrzeug zu retten. Was auch immer Sie tun: Treffen Sie die Entscheidung informiert. Ein unabhängiges Gutachten und ein offenes Gespräch mit Ihrem Anwalt helfen dabei. Und egal wie Sie entscheiden – Stellen Sie sicher, dass die Versicherung den entsprechenden Betrag auch tatsächlich zahlt, sei es an die Werkstatt oder an Sie. Bei Unklarheiten nutzen Sie Ihren Rechtsbeistand.
Typische Tricks der Versicherungen – und wie Sie sich schützen
Leider erlebt man es immer wieder: Versicherungen versuchen, bei der Regulierung zu sparen, oft mit Methoden, die für den Laien schwer durchschaubar sind. Denken Sie daran: Die Versicherung des Unfallgegners ist ein Wirtschaftsunternehmen. Deren Mitarbeiter sind geschult, Zahlungen zu minimieren. In diesem Kapitel decken wir einige der häufigsten „Tricks“ und Taktiken auf, mit denen Geschädigte konfrontiert werden – und zeigen, wie Sie sich dagegen wehren können. Das soll keine Generalabrechnung mit Versicherungen sein; viele regulieren korrekt. Aber wenn versucht wird, Sie zu benachteiligen, sollten Sie darauf vorbereitet sein.
Trick 1: Freundlichkeit mit Hintergedanken („Ihr Schadenmanager“): Wie schon in Kapitel 5 besprochen, melden sich Versicherer gern proaktiv telefonisch und geben sich hilfsbereit. „Wie geht es Ihnen? Wir kümmern uns um alles, Sie brauchen keinen Anwalt, das schaffen wir schon.“ – Solche Gespräche zielen darauf ab, Vertrauen aufzubauen, damit Sie am Ende ohne eigene Hilfe auf ihre Vorschläge eingehen. Vielleicht entlockt man Ihnen auch gleich ein paar Aussagen, die später genutzt werden können (z.B. „so schlimm sieht der Schaden ja nicht aus“ – und prompt wird gekürzt). Ihr Schutz: Bleiben Sie höflich, aber bestimmt. Geben Sie keine weitreichenden Infos und lassen Sie sich nicht auf Versprechungen ein. Am besten verweisen Sie gleich an Ihren Anwalt. Lassen Sie sich alle Angebote schriftlich geben und unterschreiben Sie nichts vorschnell.
Trick 2: Schadenspositionen „vergessen“ oder kleinrechnen: Ein sehr häufiger Trick: Einfach nicht von selbst erwähnen, was dem Geschädigten zusteht. Viele Versicherungen zahlen z.B. klaglos die Reparaturkosten, aber Wertminderung und Nutzungsausfall erwähnen sie mit keinem Wort – in der Hoffnung, der Laie kennt das nicht. Oder sie schicken nur einen Scheck über die Netto-Summe, ohne MwSt, obwohl klar ist, dass Sie reparieren (hier müssen Sie dann nachhaken mit der Rechnung). Ihr Schutz: Dank dieses Ratgebers kennen Sie ja nun alle Positionen. Prüfen Sie jeden Bescheid der Versicherung: Was wurde bezahlt, was nicht? Stimmen die Beträge mit dem Gutachten/den Rechnungen überein? Wenn Positionen fehlen (z.B. kein Geld für Wertminderung oder die Pauschale), schreiben Sie – oder besser Ihr Anwalt – sofort zurück und fordern das ein. Lassen Sie sich nicht abwimmeln.
Trick 3: Verweis auf günstigere Werkstatt / niedrigere Stundensätze: Versicherer argumentieren oft, die Reparatur ließe sich in einer „Partnerwerkstatt“ günstiger durchführen, oder sie kürzen Stundenverrechnungssätze mit dem Hinweis, Ihre Werkstatt sei zu teuer. Grundsätzlich gilt: Im Haftpflichtfall (Sie sind Geschädigter) dürfen Sie eine Markenwerkstatt beauftragen, vor allem bei einem relativ neuen Fahrzeug. Die Versicherung kann Sie nur auf eine günstigere „freie“ Werkstatt verweisen, wenn Ihr Wagen schon älter ist, kein Scheckheft etc. – und auch dann nur, wenn die Alternativwerkstatt gleichwertige Qualität bietet. Oft sind solche Verweise angreifbar (z.B. Werkstatt viel weiter weg, oder kein echter Markenservice, was Garantie beeinflussen kann). Ihr Schutz: Haben Sie guten Grund für Ihre Werkstattwahl, teilen Sie das mit. Lassen Sie den Anwalt ggf. klarstellen, dass der Verweis unzumutbar ist.
Trick 4: Eigener Gutachter der Versicherung: Manche Versicherungen schicken ungefragt einen eigenen Sachverständigen oder einen „Gutachter“ vom Dienst, um den Schaden anzusehen. Sie dürfen diesem nicht Ihr Auto verweigern, aber Sie müssen sich nicht auf sein Gutachten allein verlassen. Oft wird es kürzer treten, also z.B. günstigere Teile ansetzen oder bestimmte Schäden als nicht unfallbedingt darstellen. Ihr Schutz: Bestehen Sie auf Ihrem Gutachten (wenn Sie selbst noch keins hatten, spätestens jetzt einen unabhängigen Gutachter einschalten). Weisen Sie die Versicherung darauf hin, dass Sie gemäß § 249 BGB das Gutachten Ihres Vertrauens heranziehen. Im Zweifel müssen Gerichte entscheiden, welches Gutachten überzeugender ist – meist das unabhängig beauftragte. Lassen Sie sich nicht einreden, ein eigener Gutachter sei „nicht erlaubt“ – das behaupten manche, aber es ist falsch. Die ADAC und Automobilclubs warnen ausdrücklich vor diesem Punkt und empfehlen, auf einem eigenen Gutachter und Anwalt zu bestehen.
Trick 5: „Schadenmanagement“-Angebote: Versicherungen bieten Komplettpakete: kostenloser Abschleppdienst, Werkstattservice, Ersatzwagen, Reinigung – alles klingt toll. Der Haken: Sie geben damit quasi den Fall aus der Hand. Der Wagen geht in eine Partnerwerkstatt der Versicherung. Dort wird evtl. billiger repariert (manchmal mit Gebrauchtteilen), Sie erfahren vielleicht nicht alle Details. Möglicherweise verzichten Sie damit stillschweigend auf die Wertminderung, weil die Versicherung diese in dem Paket „vergisst“. Oder die Werkstatt ist nicht herstellerzertifiziert, was Ihre Garantie kostet. Es gab Fälle, da wurde dem Kunden nach so einer Partnerreparatur später ein geringerer Wiederverkaufswert bestätigt, weil eben kein Originalservice. Ihr Schutz: Überlegen Sie gut, ob Sie das Angebot annehmen. Lassen Sie sich schriftlich geben, worauf Sie ggf. verzichten. Oft steckt im Kleingedruckten, dass damit „alle Ansprüche abgegolten“ sind, was gefährlich wäre. In der Regel ist es besser, eigenständig zu handeln: eigenen Gutachter, eigene Werkstatt, Mietwagen selber buchen. So behalten Sie die Hoheit.
Trick 6: Herauszögern der Zahlung: Manchmal lässt sich die Versicherung extrem viel Zeit mit der Regulierung, in der Hoffnung, der Geschädigte gibt auf oder nimmt ein niedriges Vergleichsangebot an, um endlich Geld zu sehen. Sie warten und warten, telefonieren hinterher, es passiert wenig. Ihr Schutz: Setzen Sie Fristen! Wenn alle Unterlagen vorliegen (Gutachten, Anspruchsaufstellung), ist eine Regulierungsfrist von etwa 4-6 Wochen angemessen. Danach gerät die Versicherung in Verzug. Ihr Anwalt wird dann Mahnen und ggf. Klage androhen. Sie können sogar Verzugszinsen verlangen. Wichtig ist, dass wirklich alle Unterlagen vollständig eingereicht wurden – erst dann beginnt die Frist. Also sorgen Sie dafür (bzw. Anwalt), dass nichts fehlt. Lassen Sie sich nicht mit Ausreden („liegt beim Prüfer“, „ist in Arbeit“) ewig vertrösten – bleiben Sie dran, in hartnäckigen Fällen hilft nur der Rechtsweg.
Trick 7: Teil-Schuldvorwurf aus dem Hut zaubern: Eine dreiste Masche: Obwohl die Lage klar erscheint, behauptet die gegnerische Versicherung plötzlich, Sie hätten eine Teilschuld. Etwa: „Ihr Mandant fuhr mit abgefahrenen Reifen, deshalb 20% Mitverschulden“. Oder konstruiert einen angeblichen Fehler Ihrerseits. Ziel: nur einen Teil der Ansprüche zahlen, Sie sollen froh sein überhaupt was zu kriegen. Ihr Schutz: Lassen Sie sich davon nicht ins Bockshorn jagen. Wenn Sie wirklich nicht schuld sind, bleiben Sie standhaft. Verlangen Sie Belege für den Vorwurf. Oft ist es ein Bluff. Selbst wenn eine geringe Teilschuld denkbar wäre – Ihr Anwalt kann das prüfen und oft entkräften (z.B. waren die Reifen okay, und selbst wenn nicht, war das nicht unfallursächlich). Notfalls klagen: Bei strittiger Haftung entscheidet ein Gericht. Viele Versicherungen rudern zurück, wenn sie merken, Sie lassen sich nicht abfinden.
Zusammengefasst: Seien Sie wachsam. Nicht jede Versicherung trickst – aber seien Sie darauf gefasst, falls doch. Kennen Sie Ihre Rechte (jetzt tun Sie es) und nutzen Sie Unterstützung. Wenn etwas unplausibel klingt, holen Sie Rat ein. Dokumentieren Sie alles, kommunizieren schriftlich, nutzen Sie Gutachter und Anwalt. So nehmen Sie den meisten Tricks den Wind aus den Segeln. Lassen Sie sich nicht einschüchtern oder entmutigen – genau darauf zielen manche Taktiken ab. Am Ende geht es um Ihr Geld und Ihr Recht, und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Mit Wissen und kompetenter Hilfe stehen die Chancen sehr gut, dass Sie bekommen, was Ihnen zusteht.
Besondere Fälle – Fahrerflucht, Personenschaden, Ausland, Leasing u.v.m.
Nicht jeder Unfall läuft nach Schema F ab. Es gibt Sonderfälle, die zusätzliche Fragen aufwerfen: Was, wenn der Unfallgegner flüchtet und gar nicht ermittelt werden kann? Wie verhalte ich mich, wenn ich selbst verletzt wurde? Was ist anders, wenn der Unfall im Ausland passiert? Und worauf muss ich achten, wenn es ein Firmenwagen oder Leasingfahrzeug betrifft – oder wenn ein Fahrrad/E-Bike im Spiel ist? In diesem Kapitel beleuchten wir solche Situationen und geben konkrete Hinweise, was zu tun ist.
Unfall mit Fahrerflucht – wenn der Verursacher unauffindbar ist
Situation: Sie kommen zu Ihrem geparkten Auto und stellen einen erheblichen Schaden fest – weit und breit kein Verursacher. Oder schlimmer: Im fließenden Verkehr werden Sie von einem anderen Fahrzeug angefahren, der Fahrer hält nicht an, sondern rast davon. Fahrerflucht (Unfallflucht) ist nicht nur unfair, sondern eine Straftat (§ 142 StGB). Für Sie als Geschädigten ist es besonders frustrierend, weil zunächst keiner da ist, der zahlt.
Was sofort tun? Rufen Sie umgehend die Polizei. Bei Parkremplern hinterlassen Täter gern einen Zettel – glauben Sie nicht, dass das reicht. Oft sind Angaben falsch oder es melden sich Leute dann doch nicht. Ein Zettel ist kein sicheres Mittel, den Schaden zu melden. Bestehen Sie auf einer polizeilichen Aufnahme, das schafft zumindest einen offiziellen Vorgang. Notieren Sie mögliche Zeugen (Nachbarn, Passanten) oder bitten Sie um Videoaufnahmen, falls z.B. in einer Tiefgarage Kameras sind. Machen Sie Fotos vom Schaden und der Umgebung.
Eigene Versicherung einschalten: Informieren Sie umgehend Ihre eigene Kfz-Versicherung. Wenn der Verursacher unbekannt bleibt, können Sie Ihren Schaden eventuell über Ihre Vollkasko regulieren. Das hat zwar Nachteile (Selbstbeteiligung, Hochstufung), aber zumindest bleiben Sie nicht komplett auf Kosten sitzen. Manche Vollkasko-Versicherer verzichten bei nachweislicher Fahrerflucht auf die Rückstufung – fragen Sie nach den Bedingungen. Achtung: Wenn Sie Kasko in Anspruch nehmen, erfüllen Sie alle dortigen Pflichten (z.B. Strafanzeige erstatten, Polizei informieren – das haben Sie dann ja getan).
Verkehrsopferhilfe: In Deutschland gibt es den „Fonds der Verkehrsopferhilfe“, getragen von den Versicherungen. Dieser tritt ein, wenn der Schadenverursacher nicht ermittelt werden kann oder nicht versichert war. Allerdings ersetzt die Verkehrsopferhilfe Sachschäden nur in engen Grenzen – hauptsächlich werden Personenschäden (Verletzungen) entschädigt. Sachschaden wird nur unter bestimmten Voraussetzungen gezahlt (z.B. erheblicher Personenschaden involviert oder hoher Sachschaden mit besonderer Härte). Das heißt: Ist „nur“ Ihr Auto beschädigt und niemand verletzt, haben Sie leider geringe Chancen auf Zahlungen aus diesem Fonds. Bei Verletzungen jedoch können Sie dort Schmerzensgeld und Heilkosten geltend machen. Ihr Anwalt kann sich an die Verkehrsopferhilfe wenden.
Falls der Flüchtige ermittelt wird: Die Polizei hat durchaus Erfolg in vielen Fällen – sei es durch Zeugenhinweise oder Spuren am Unfallort (Lackreste etc.). Wenn der Unfallgegner nachträglich ermittelt wird, können Sie nachträglich alle Ansprüche gegen ihn bzw. seine Versicherung geltend machen, als wäre er nicht geflohen. Zudem kommt auf ihn eine Strafanzeige zu. Wichtig: In dem Moment, wo er bekannt ist, informieren Sie wieder Ihren Anwalt und die Versicherung – dann läuft das normale Prozedere (Gutachter, Forderungsschreiben) gegenüber seiner Haftpflicht an. Wenn Sie in der Zwischenzeit Ihre Kasko bemüht haben, muss die gegnerische Versicherung diese erstatten (Subrogation), und Sie bekommen Ihre evtl. Selbstbeteiligung zurück.
Strafanzeige stellen: Sie selbst sollten unbedingt Anzeige gegen Unbekannt erstatten (bzw. wird die Polizei vor Ort das tun). Das ist wichtig, auch um ggf. Ansprüche aus Verkehrsopferhilfe o.Ä. zu sichern. Wenn der Täter später gefasst wird, können Sie im Strafverfahren als Nebenkläger oder zumindest als Zeuge auftreten und gegebenenfalls Ihren Schaden dort anmelden (Adhäsionsverfahren), aber meistens läuft es zivilrechtlich separat.
Unfallschaden begutachten lassen: Auch ohne bekannten Gegner sollten Sie den Schaden von einem Gutachter begutachten lassen, vor allem wenn Sie Vollkasko geltend machen wollen oder für den Fall, dass der Gegner doch noch gefunden wird. Das Gutachten dient der Beweissicherung. Ihr Kasko-Versicherer wird ggf. selbst einen Gutachter schicken; dennoch schadet ein eigenes Gutachten nicht, wenn Kasko nicht zahlt.
Zusammengefasst: Fahrerflucht macht alles komplizierter. Aber gehen Sie systematisch vor: Polizei, Dokumentation, Versicherung informieren, Gutachten. Nutzen Sie vorhandene Auffangnetze (Kasko, Verkehrsopferhilfe). Und ganz wichtig: Melden Sie jeden Parkrempler der Polizei, auch wenn es klein erscheint. Sonst könnten Sie selbst in Verdacht geraten, die Unfallflucht begangen zu haben, was Ihren Versicherungsschutz gefährden könnte.
Personenschaden – wenn Sie verletzt wurden
Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ist für die Betroffenen oft schlimmer als der Blechschaden. Schmerzen, Arztbesuche, eventuell Krankenhaus oder Reha – das ist belastend. Zudem kommen rechtliche Besonderheiten hinzu. Hier ist der wichtigste Rat: Gesundheit geht vor! Kümmern Sie sich zunächst um die medizinische Versorgung und Genesung. Parallel dazu sollten Sie (bzw. Ihr Anwalt) die Weichen stellen, damit Sie angemessen entschädigt werden.
Arzt und Dokumentation: Wie schon betont, gehen Sie sofort zum Arzt, auch bei vermeintlich leichten Verletzungen. Jede Diagnose und jeder Zusammenhang mit dem Unfall muss aktenkundig sein, um später Ansprüche zu untermauern. Folgen Sie den ärztlichen Anweisungen (z.B. Physiotherapie), schon um Ihrer Gesundheit willen.
Schmerzensgeld: Ihr Anspruch auf Schmerzensgeld ist zentraler Bestandteil der Personenschadensregulierung. Sobald absehbar ist, wie schwer und langwierig Ihre Verletzungen sind, wird Ihr Anwalt eine Forderung formulieren. Hier fließen viele Faktoren ein: Verletzungsart, Heilungsdauer, Ausmaß dauerhafter Beeinträchtigung, ggf. Mitverschulden des Gegners (oder Ihrerseits). Es kann sinnvoll sein, mit der Bezifferung zu warten, bis der Heilungsverlauf klar ist – bei schweren Verletzungen also erst nach Abschluss der Behandlung oder wenn ein Arzt eine Prognose abgibt. Zur Orientierung: Anwälte nutzen Schmerzensgeldtabellen (Sammlungen vergangener Urteile), um einen Betrag X zu nennen. Die Versicherung wird meist niedriger ansetzen und es entsteht eine Verhandlung. Haben Sie Geduld und lassen Sie verhandeln. Nehmen Sie nicht vorschnell das erstbeste Angebot an, wenn es unangemessen niedrig erscheint. Beispiel: Nach einem Schleudertrauma mit 2 Wochen Schmerzen könnten ~500 € angemessen sein. Nach einem Beinbruch mit OP und 3 Monaten Krücken vielleicht 3.000–5.000 €. Die Bandbreite ist groß.
Heilbehandlungskosten: In der Regel geht das über Ihre Krankenversicherung. Sie müssen hier nicht viel tun, außer Ihre Unfallgegner-Daten ggf. der Krankenkasse zu melden. Diese klärt das mit der gegnerischen Haftpflicht (Regress nach § 116 SGB X). Wenn Sie privat versichert sind, reichen Sie Rechnungen ein wie üblich – Ihre Versicherung holt sich das Geld wieder. Für Sie wichtig: Eigenanteile und Zusatzkosten (wie spezielles Schmerzmittel, das selbst bezahlt wurde) notieren und sammeln, damit Sie diese erstattet bekommen.
Verdienstausfall und Folgekosten: Wenn Sie beruflich ausfallen, lassen Sie sich vom Arbeitgeber bescheinigen, ab wann er nicht mehr zahlt (nach 6 Wochen) und wie hoch Ihr Nettoverlust ist. Krankenkasse-Bescheinigungen über Krankengeld sind auch relevant. Diese Unterlagen gibt man am besten gesammelt dem Anwalt. Haushaltsführungsschaden haben wir erwähnt – überlegen Sie, ob Sie im Haushalt Hilfe brauchten (z.B. Nachbarn, Familie geholfen) und dokumentieren Sie Umfang und Dauer. Jede regelmäßige Aktivität, die Sie nicht tun konnten (Haushalt, Gartenarbeit, Kinderbetreuung), kann im Prinzip in Geldwert gefordert werden, wenn Sie dadurch auf Hilfe angewiesen waren.
Dauerfolgen: Wenn absehbar ist, dass der Unfall bleibende Schäden hinterlässt (z.B. ein steifes Gelenk, Narben, psychische Traumata), wird die Entschädigung komplexer. Man spricht dann von Schmerzensgeldrente oder Kapitalentschädigungen für Invalidität. Hier sollten unbedingt Spezialisten (ggf. Fachanwälte, medizinische Gutachter) hinzugezogen werden, um nichts zu übersehen. Das sprengt aber diesen Ratgeber – in solchen Fällen unbedingt rechtlichen Beistand nehmen.
Mitverschulden bei Verletzungen: Beachten Sie, dass ein Mitverschulden Ihre Ansprüche anteilig mindert (siehe nächster Abschnitt 9.3). Ein Sonderthema: Gurtmuffel – wer keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte und verletzt wird, dem kann eine Mitschuld angerechnet werden, weil er den Schaden (die Verletzungsschwere) erhöht hat. Das kann Schmerzensgeld um z.B. 25% kürzen. Gleiches bei nicht getragenem Helm (Motorrad, Fahrrad). Seien Sie hier ehrlich mit Ihrem Anwalt, damit man das realistisch einschätzen kann.
Psyche und Trauma: Scheuen Sie sich nicht, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn der Unfall seelisch nachwirkt (Angst vorm Autofahren, Flashbacks etc.). Diese Behandlung zählt ebenfalls zu Heilbehandlungskosten. Schmerzensgeld kann auch für seelisches Leid berücksichtigt werden.
Zusammengefasst: Personenschäden erfordern einen langen Atem. Während Blech meist in Wochen repariert ist, können Verletzungen Monate beanspruchen. Dokumentieren Sie alles medizinische. Übereilen Sie keinen Abschluss mit der Versicherung, solange Sie nicht genesen oder stabil sind – ansonsten vereinbaren Sie einen Vorbehalt oder streben einen Teil-Schmerzensgeld jetzt, Rest je nach Ausgang an. Gute Versicherer warten hier sogar ab, anstatt schnell billig abzufinden. Hören Sie auf anwaltlichen Rat. Und das Wichtigste: Werden Sie gesund! Nutzen Sie die Ihnen zustehenden Mittel für Therapie, Reha, Haushaltshilfe – es soll Ihnen ja möglichst bald wieder gut gehen.
Mitverschulden – wenn die Schuld nicht 100% klar ist
Bisher sind wir vom Idealfall ausgegangen: Sie selbst trifft keine Schuld. Die Realität ist aber oft komplizierter – es gibt Unfälle mit geteiltem Verschulden. Das Prinzip des Mitverschuldens (§ 254 BGB) bedeutet, dass jeder nach seinem Anteil haftet. Z.B. 50/50, 25/75 usw. Beispiele: Einer missachtet die Vorfahrt, aber der andere war auch zu schnell – beide tragen Teilschuld. Oder Auffahrunfall: typischerweise ist der Hintermann schuld, aber wenn der Vordermann grundlos voll bremst, kann er eine Mitschuld tragen. In solchen Fällen werden Ansprüche gekürzt – also Sie bekommen z.B. nur 50% Ihres Schadens ersetzt, müssen umgekehrt aber 50% vom Schaden des anderen (über Ihre Versicherung) tragen.
Warum gehört das in diesen Ratgeber? Weil auch bei vermeintlich unverschuldeten Unfällen die gegnerische Versicherung manchmal Mitverschulden behauptet. Wir haben das als Trick erwähnt. Sie sollten das Grundprinzip verstehen: Wenn tatsächlich eine Teilschuld besteht, müssen auch bestimmte Kosten (Gutachter, Anwalt) anteilig selbst getragen werden. Allerdings: Solange keine offizielle Klärung (z.B. Urteil) vorliegt, gehen Sie erst mal von voller Gegnerschuld aus. Lassen Sie die Versicherungen das unter sich klären. Gestehen Sie nichts vorschnell ein. Sollte es Indizien für Mitverschulden geben, besprechen Sie mit Ihrem Anwalt die Strategie. Vielleicht lässt sich die Quote reduzieren (statt 50% nur 20%). Vielleicht sind die Vorwürfe haltlos.
Wenn schließlich eine Quote feststeht, werden alle Zahlungen entsprechend geteilt. Beispiel: Man einigt sich auf 25% Mitverschulden bei Ihnen. Dann zahlt gegnerische Versicherung 75% Ihrer Schäden; Ihre zahlt 25% der Schäden des Gegners (sofern der überhaupt was fordert), und 25% der Gutachter/Anwaltkosten bleiben Ihr „Anteil“. Das wäre bitter, aber immer noch besser als mehr.
Tipp: Das Thema zeigt nochmals, warum Beweise so wichtig sind. Oft lässt sich ein Mitverschuldensvorwurf entkräften, wenn man den Ablauf gut dokumentiert hat oder Zeugen hat. Manche Mitschuld kann man auch rechtlich abwehren – z.B. die erwähnte Betriebsgefahr (jedes Auto hat eine Grundgefahr, die theoretisch immer eine Minithaftung bedeutet, aber die tritt bei reinem Fremdverschulden faktisch zurück). Kurz: Unverschuldet heißt: tun Sie alles dafür, dass es auch als unverschuldet anerkannt wird. Dann kommt das gar nicht erst ins Spiel.
Unfall im Ausland (und mit ausländischem Beteiligten)
Unfälle im Ausland oder mit einem ausländischen Fahrzeug sind komplizierter, weil unterschiedliche Rechtsordnungen und Zuständigkeiten ins Spiel kommen. Hier ein grober Überblick:
Unfall im EU-Ausland: Dank EU-Regelungen (insbesondere der 4. KH-Richtlinie) ist es leichter geworden. Wenn Sie z.B. in Frankreich oder Italien einen Unfall erleiden, greifen die Länder-Vorschriften zum Unfallhergang (Verkehrsrecht des Landes). Ihre Ansprüche richten sich aber nach dem dortigen Recht. Jedoch dürfen Sie als deutscher Geschädigter einen Anwalt und Gutachter aus Deutschland einschalten, selbst wenn der Unfall im Ausland passierte. Zudem hat jedes Versicherungsunternehmen in der EU einen Vertreter in jedem anderen Land. D.h., Sie können Ihren Schaden in Deutschland bei einem Regulierungsbeauftragten der ausländischen Versicherung anmelden. Es gibt das „Deutsche Grüne Karte Büro“ in Hamburg, das hilft, den richtigen Ansprechpartner zu finden. Achtung: Entschädigungspraxis und Höhen können von deutschen Standards abweichen. In manchen Ländern sind Schmerzensgelder viel niedriger, Mietwagen wird kürzer gezahlt etc. Das anwendbare Recht richtet sich meist nach Unfallort. Lassen Sie sich hier unbedingt vom Anwalt beraten, idealerweise einem mit Auslandserfahrung. Wichtig: Immer die Grüne Versicherungskarte (oder eVB) mitführen, wenn Sie ins Ausland fahren, und einen europäischen Unfallbericht. Das erleichtert die Abwicklung vor Ort.
Unfall außerhalb der EU: Hier gilt das jeweilige nationale Recht. Die Regulierung kann sich ziehen (andere Sprachen, andere Gesetze, teilweise kein Pflichtversicherungssystem!). Wenn z.B. in der Türkei ein Unfall passiert, müssen Sie sich an den dortigen Versicherer wenden, oft über einen Korrespondenten hier. Die Kommunikation in fremder Sprache und die oft längere Dauer sind Herausforderungen. Es kann Monate dauern. In solchen Fällen ist ein Anwalt, der mit internationalen Fällen vertraut ist, Gold wert. ADAC oder Auslandsclubs können oft unterstützen. Tipp: Vor Auslandsfahrten informieren, welche Besonderheiten es gibt (manche Länder haben keine Vollkasko-Kultur etc.). Immer die notwendigen Dokumente dabeihaben (Grüne Karte, Notfallnummern).
Unfall mit ausländischem Fahrzeug in Deutschland: Hier gilt deutsches Recht, aber der Unfallgegner hat evtl. eine ausländische Versicherung. Auch dafür gibt es das Grüne Karte System: In Deutschland gibt es für fast jede ausländische Versicherung einen inländischen Regulierungsbeauftragten. Über den Zentralruf der Autoversicherer können Sie nicht nur inländische, sondern auch ausländische Versicherungen erfragen (wenn Kennzeichen bekannt und Land). Dann meldet man den Schaden hier beim zuständigen Büro. Das Verfahren läuft ähnlich wie mit einer deutschen Versicherung, kann aber mitunter länger dauern.
Besonderheit: Mietwagen im Ausland: Wenn Sie im Ausland mit einem Mietwagen einen unverschuldeten Unfall haben, meldet man es natürlich dem Vermieter und der Polizei. Die eigene Haftpflicht des Gegners kommt für den Schaden auf, aber oft werden Sie trotzdem angehalten, via Kreditkarte den Selbstbehalt vorzulegen. Hier ist das Thema Travel vs. Haftpflicht – führt jetzt zu weit, aber wichtig: Immer Vollkasko ohne SB bei Mietwagen nehmen, dann sind Sie auf der sicheren Seite, egal wer schuld war.
Insgesamt: Unfall im Ausland = komplex, aber mit EU im Rahmen machbar. Holen Sie sich Hilfe (z.B. Automobilclub). Ihre Rechte bleiben gewahrt, aber die Durchsetzung erfordert noch mehr Geduld und gute Nerven. Dokumentieren Sie vor Ort umso mehr (Fotos, ggf. Übersetzungen anfertigen lassen).
Unfall mit einem Leasingfahrzeug oder Firmenwagen
Wenn das beschädigte Fahrzeug nicht Ihnen privat gehört, sondern geleast oder ein Dienstwagen Ihres Arbeitgebers ist, kommen ein paar Besonderheiten ins Spiel.
Leasingfahrzeug: Bei Leasing sind Sie Nutzer, der Eigentümer ist die Leasinggesellschaft. Grundsätzlich: Bei einem unverschuldeten Unfall muss der Schaden genauso reguliert werden wie sonst, aber die Auszahlung geht an den Eigentümer (die Leasingfirma), soweit es das Fahrzeug betrifft. Praktisch heißt das:
- Schadenmeldung: Informieren Sie unbedingt sofort die Leasinggesellschaft. Im Leasingvertrag steht meist, dass Unfälle gemeldet werden müssen. Der Leasinggeber will sicherstellen, dass das Auto fachgerecht instand gesetzt wird, da es sein Vermögenswert ist.
- Reparatur: Oft schreibt der Leasingvertrag vor, dass das Fahrzeug bei einem Markenbetrieb repariert werden muss (Originalteile), um den Wert zu erhalten. Das passt gut zu Ihren Rechten, denn Sie dürfen ja Ihre Werkstatt wählen. Stimmen Sie mit der Leasingfirma ab, wo repariert werden soll – meist haben die nichts dagegen, dass Sie in die Markenwerkstatt gehen, eher im Gegenteil. Die Versicherung des Unfallgegners zahlt die Reparaturkosten.
- Totalschaden: Hier wird es knifflig. Wenn das Auto ein Totalschaden ist, zahlt die gegnerische Versicherung den Wiederbeschaffungswert an den Leasinggeber (Eigentümer). Problem: Ihr Leasingvertrag läuft vielleicht noch, und Sie schulden ggf. eine Vorfälligkeitsentschädigung oder es entsteht eine Lücke zwischen Ablöse (Leasingrestwert) und Wiederbeschaffungswert. Viele Leasingverträge beinhalten eine GAP-Versicherung (Gap = Lücke), die diese Differenz abdeckt. Prüfen Sie, ob Sie so etwas haben. Falls nicht, könnten Sie theoretisch den Unfallgegner auf die Differenz haftbar machen, aber das deutsche Schadenrecht ersetzt nur den objektiven Fahrzeugwert, nicht Finanzierungsverluste. In der Regel bleibt eine Deckungslücke Ihr Problem, es sei denn, man argumentiert Vertragsstrafe etc. Hier unbedingt mit Leasingfirma und Anwalt beraten.
- Wertminderung: Wer bekommt die Wertminderung ausgezahlt? Prinzipiell der Leasinggeber, aber oft vereinbart man, dass diese dem Leasingnehmer gutgeschrieben wird. Klären Sie das. Häufig wird bei Rückgabe eines Unfallfahrzeugs der Minderwert fällig – wenn er aber von der Versicherung erstattet wurde, sollte er an Leasinggeber gehen und Sie sollten keine extra Rechnung bei Rückgabe erhalten.
- Kosten Gutachter/Anwalt: Diese dürfen Sie natürlich trotzdem einschalten. Informieren Sie die Leasingfirma, dass ein Gutachter kommt – eventuell bestehen sie auf einem eigenen oder wollen das Koordinieren. Lassen Sie idealerweise einen unabhängigen Gutachter den Schaden fürs Protokoll aufnehmen (vielleicht in Absprache mit Leasing). Die gegnerische Versicherung zahlt wie gehabt.
- Leasingrate: Wenn das Auto länger in Reparatur ist, zahlen Sie weiter Leasingraten ohne das Auto zu nutzen. Theoretisch kann man argumentieren, dass auch das ein Schaden ist. Praktisch wird das meist durch Nutzungsausfall/Mietwagen abgegolten, den Sie ja in Anspruch nehmen können. Die Leasingrate an sich wird Ihnen keiner erstatten, aber indirekt nutzen Sie ja einen Mietwagen auf Kosten der Versicherung.
Firmenwagen (Dienstwagen): Hier gehört das Fahrzeug Ihrem Arbeitgeber oder einer Firma. Einige Punkte:
- Schadenmeldung intern: Melden Sie den Unfall sofort Ihrem Arbeitgeber. In größeren Firmen gibt es evtl. einen Fuhrparkmanager oder zumindest die Versicherung der Firma, die involviert werden muss.
- Haftung: Bei fremdverschuldetem Unfall zahlt natürlich der Unfallgegner. Ihrem Arbeitgeber entsteht ein Schaden (am Auto), den er ersetzt bekommt. Ihnen persönlich entstehen evtl. Schäden (z.B. Eigenanteil falls vereinbart, persönliche Gegenstände, Verletzungen), die Sie separat geltend machen.
- Abwicklung: In vielen Fällen übergibt der Arbeitgeber die Schadenabwicklung seiner Firmenversicherung oder einem Anwalt. Eventuell läuft es wie Leasing: Das Auto wird repariert und die gegnerische Versicherung zahlt direkt an die Firma. Für Sie ist wichtig: Persönliche Ansprüche wie Schmerzensgeld oder Verdienstausfall (wenn Sie arbeitsunfähig sind) müssen Sie selbst geltend machen, idealerweise mit eigenem Anwalt. Der Arbeitgeber kann den Sachschaden regeln.
- Selbstbeteiligung des Arbeitnehmers? Manche Arbeitsverträge sehen vor, dass der Arbeitnehmer bei selbstverschuldeten Unfällen eine SB trägt. Aber hier sind Sie ja nicht schuld, also sollte das nicht zum Tragen kommen. Ihr Chef darf Sie für fremdverschuldete Schäden grundsätzlich nicht belangen. Sollte er trotz Fremdverschulden etwas abziehen, sprechen Sie mit dem Anwalt – das wäre unrechtmäßig.
- Nutzungsausfall/Mietwagen: Bekommen Sie einen Ersatzwagen vom Arbeitgeber gestellt? Viele Firmen haben Poolfahrzeuge. Wenn nicht, müssten Sie theoretisch Nutzungsausfall geltend machen. Aber dieser stünde dann der Firma zu, weil es deren Fahrzeug ist. Praktisch regelt das meist der Arbeitgeber: Er besorgt Ersatz (auf Versicherungskosten) oder lässt das über die gegnerische Versicherung laufen.
- Privat genutzter Dienstwagen: Falls Sie den Firmenwagen auch privat nutzen durften, und der ist jetzt weg, können Sie argumentieren, dass Ihnen persönlich Nutzungsausfall entsteht für die private Nutzungstage. Das ist kompliziert und selten extra geltend gemacht, aber denkbar. Oft ist das im Nutzungsausfall der Firma drin.
Kurzum: Bei Leasing und Firmenwagen ist Kommunikation mit dem Eigentümer (Leasingfirma/Arbeitgeber) entscheidend. Halten Sie Absprachen ein, dokumentieren Sie für diese auch alles sauber (Gutachten, etc.). Ihre eigenen Rechte – wie Schmerzensgeld oder Ersatz persönlicher Sachen – bestehen natürlich daneben und müssen von Ihnen eingefordert werden. Im Idealfall unterstützen Leasinggeber und Arbeitgeber Sie, da auch sie Interesse an voller Schadensregulierung haben.
Fahrrad- oder E-Bike-Unfall – besondere Konstellationen
Immer mehr Menschen sind mit Fahrrad oder E-Bike/E-Scooter unterwegs. Unfälle zwischen Autofahrern und diesen „schwächeren Verkehrsteilnehmern“ unterscheiden sich in der Abwicklung, je nachdem wer schuld ist. Hier die gängigen Szenarien aus Sicht eines Autofahrers und eines Radfahrers:
- Sie als Autofahrer, unverschuldet mit Radfahrer kollidiert: Beispiel: Ein Radfahrer nimmt Ihnen die Vorfahrt und prallt in Ihr Auto. Ihr Auto hat Schaden, Sie keine Schuld. In diesem Fall haftet der Radfahrer für Ihren Schaden. Allerdings hat der Radfahrer kein Pflichtversicherung wie ein Kfz. Idealerweise hat er eine Privathaftpflichtversicherung, die solche Schäden deckt. Viele Menschen haben das. Sie müssen dann Ihre Ansprüche (Auto reparieren etc.) gegenüber dem Radfahrer bzw. dessen Privathaftpflicht geltend machen. Praktisch tut das oft Ihre eigene Kfz-Haftpflicht für Sie (Regress), oder Sie selbst mit Anwalt. Falls der Radfahrer keine Haftpflicht hat, müssten Sie ihn persönlich auf Schadenersatz verklagen, was mühsam sein kann. Es greift kein Verkehrsopferhilfe-Fonds, weil der gilt nur für Kfz. Positiv: Oft sind Sachschäden überschaubar, aber Personenschaden könnte größer sein – siehe unten.
- Sie als Radfahrer/E-Bike-Fahrer, unverschuldet von Auto angefahren: Hier gilt: Der Autofahrer bzw. dessen Kfz-Haftpflicht zahlt Ihnen alle Schäden (Fahrradschaden, ggf. Heilkosten, Schmerzensgeld). Allerdings haben Gerichte in vielen Fällen dem Auto eine Betriebsgefahr von ~20% auferlegt, selbst wenn der Radfahrer formal mitschuldig war, weil der Autofahrer als „stärkerer“ eine erhöhte Sorgfaltspflicht hat. Doch wenn Sie wirklich gar keine Schuld haben, ist die Haftung klar beim Autofahrer. Ansprüche: Reparatur oder Wiederbeschaffung Ihres Fahrrads/E-Bikes, Schaden an Kleidung/Ausrüstung (Helm, Jacke etc.), Schmerzensgeld und Heilkosten bei Verletzung (leider sind Radfahrer oft die Leidtragenden körperlich), ggf. Verdienstausfall, Haushaltshilfe wie bei PKW-Personenschaden. Gutachter für Fahrrad? Bei hochwertigen Fahrrädern oder E-Bikes kann ein Sachverständiger sinnvoll sein, um den Schaden zu beziffern – das wird oft vergessen, aber auch ein Fahrrad kann z.B. einen Rahmenbruch haben, der kompliziert ist. Die Kosten dafür muss ebenfalls der Gegner tragen, sofern angemessen.
- Mischfälle: Wenn teilschuldig, wird eben gequotelt wie vorheriges Kapitel. Besonderheit: E-Scooter (Elektro-Tretroller) gelten rechtlich als Kfz, sie brauchen Versicherung. Stoßen zwei versicherte Fahrzeuge zusammen (Auto und E-Scooter), regeln es die Versicherungen ähnlich wie zwei Autos. Ein Radfahrer ohne Versicherung, der unschuldig angefahren wird, hat keinen eigenen Versicherer – aber braucht auch keinen, der Autofahrer haftet ja. Wenn der Radfahrer der Schuldige ist, siehe oben, seine Privathaftpflicht springt hoffentlich ein. Wichtig: Als Radfahrer/E-Biker sollten Sie immer Unfall aufnehmen lassen und genauso Beweise sichern wie ein Autofahrer. Nicht denken „ach, mir glaubt man eh“ – leider müssen Radfahrer oft kämpfen, ihren Anteil der Wahrheit zu beweisen. Fotos, Zeugen sind hier genauso wichtig.
Zusammengefasst: Im Kern unterscheidet es sich nicht vom KFZ-Unfall: Der Verursacher haftet. Nur dass beim Verursacher Fahrrad eben eine Privathaftpflicht statt Kfz-Versicherung zahlt – sofern vorhanden. Und als Autofahrer hat man immer eine gewisse Gefährdungshaftung, die aber bei klarer Fremdschuld des anderen de facto keine Rolle spielen sollte. Tipp: Egal auf welcher Seite – Fotos, Zeugen, Arzt (ja, auch als Radler zum Arzt!) nicht vergessen.
Fazit – Bleiben Sie souverän und nutzen Sie Ihre Rechte
Ein unverschuldeter Verkehrsunfall ist ärgerlich, stressig und manchmal einschüchternd. Plötzlich sieht man sich mit Versicherungen, Gutachten und Paragrafen konfrontiert, ohne es gewollt zu haben. Doch Sie sind dieser Situation nicht hilflos ausgeliefert. Die deutschen Gesetze bieten Ihnen als Geschädigtem umfassenden Schutz – wenn man ihn denn kennt und einfordert.
Die wichtigsten Erkenntnisse dieses Ratgebers lassen sich so zusammenfassen:
- Sicherheit und Dokumentation zuerst: Kümmern Sie sich um Unfallstelle, Hilfe für Verletzte und Beweissicherung. Das legt das Fundament für alles Weitere.
- Kennen Sie Ihre Rechte: Von A wie Abschleppkosten bis Z wie Zulassungskosten – kein legitimer Schaden bleibt unersetzbar, solange Sie unschuldig sind. Lassen Sie sich nichts einreden, was Ihnen zusteht, haben Sie hier gelernt.
- Holen Sie sich Unterstützung: Unabhängiger Gutachter und Anwalt sind nicht Luxus, sondern in einem Fremdverschulden-Fall praktisch Ihr gutes Recht und für Sie kostenlos. Sie helfen, den vollen Schadensumfang festzustellen und durchzusetzen. Nutzen Sie diese Möglichkeit. Es nimmt Ihnen viel Last von den Schultern.
- Die gegnerische Versicherung vertritt nicht Sie: So nett ein Schadenregulierer auch klingen mag – im Zweifel will er sparen, nicht Ihnen „helfen“. Vertrauen Sie daher lieber Ihren eigenen Beratern (Gutachter, Anwalt) als den Vorschlägen der Gegenseite. Bleiben Sie höflich, aber bestimmt auf Ihrer Linie.
- Nicht einschüchtern lassen: Fachchinesisch, Verzögerungstaktiken, Drohungen mit „wenn Sie Anwalt nehmen, dauert es länger“ – all das sind Maschen, um Sie vom vollen Anspruch abzubringen. Lassen Sie sich davon nicht beeindrucken. Sie haben diesen Ratgeber gelesen und wissen Bescheid. Stehen Sie selbstbewusst für Ihr Recht ein.
- Fristen und Pflichten einhalten: Melden Sie Schäden rechtzeitig, informieren Sie Ihre Versicherung, kooperieren Sie in dem nötigen Maß (Liefern von Unterlagen etc.). So geben Sie der Versicherung keinen Vorwand, etwas zu kürzen.
- Geduld haben, aber dranbleiben: Eine Regulierung kann einige Wochen, bei Personenschaden auch Monate dauern. Das ist normal – lassen Sie sich aber auch nicht unendlich hinhalten. Setzen Sie Fristen, fragen Sie nach, nutzen Sie notfalls gerichtliche Hilfe.
- Im Zweifel: Rechtsweg: Scheuen Sie nicht den Gang vor Gericht, wenn die Versicherung unvernünftig bleibt. Oft genügt schon die Klageerhebung, um Bewegung reinzubringen. Ihre Ansprüche sind durchsetzbar, und mit einem guten Anwalt haben Sie hohe Erfolgschancen, sofern die Faktenlage auf Ihrer Seite ist.
Zum Schluss sei gesagt: Kein Geld der Welt macht den Unfall ungeschehen. Aber es kann zumindest den materiellen Schaden ausgleichen und Ihnen helfen, wieder normal weiterzuleben. Darum ist es so wichtig, dass Sie bekommen, was Ihnen zusteht. Dieser Ratgeber sollte Ihnen das Rüstzeug gegeben haben, um die Unfallabwicklung souverän zu meistern. Nutzen Sie ihn als Nachschlagewerk, arbeiten Sie die Checklisten durch und zögern Sie nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Wir hoffen, dass Sie diese Informationen nie benötigen – doch falls doch, sind Sie nun gewappnet. Lassen Sie sich nicht von der gegnerischen Versicherung einschüchtern: Sie haben Rechte, und Sie können sie durchsetzen. Mit Ruhe, Wissen und Unterstützung stehen die Chancen gut, dass Sie am Ende voll entschädigt werden und der Unfall für Sie zumindest finanziell keine bleibenden Nachteile hat. In diesem Sinne: Gute Fahrt, bleiben Sie sicher – und im Fall der Fälle: handeln Sie informiert und selbstbewusst!
Hinweis: Dieser Ratgeber bietet einen Überblick und Hilfestellungen, ersetzt aber keine individuelle Rechtsberatung. Jeder Unfall hat seine Besonderheiten. Im Zweifel ziehen Sie einen Anwalt hinzu, um Ihren speziellen Fall zu prüfen. So stellen Sie sicher, dass alle Ihre Ansprüche optimal berücksichtigt werden. Bleiben Sie informiert und fahren Sie vorsichtig.