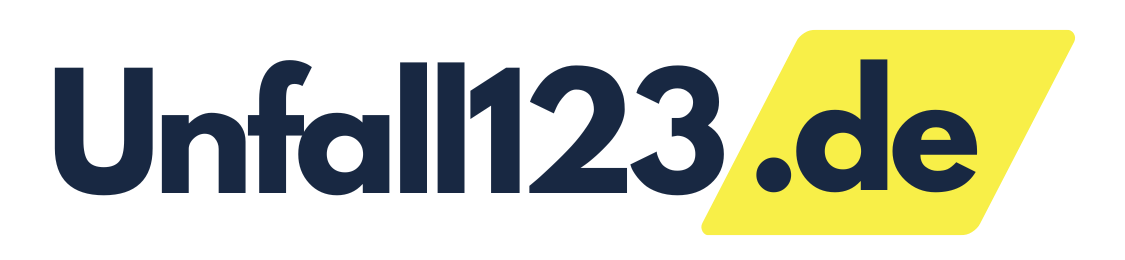Inhaltsverzeichnis
Die erste Frage: Reparieren oder nicht?
Nach einem Unfall steht zuerst die große Entscheidung an: Soll das Fahrzeug repariert oder ersetzt werden? Diese Frage ist nicht nur emotional, sondern auch rechtlich und wirtschaftlich bedeutend.
Faktoren, die die Entscheidung beeinflussen:
- Höhe des Schadens laut Gutachten
- Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs
- Alter, Zustand, Laufleistung, besondere Ausstattung
- Emotionale Bindung, Seltenheitswert
- Mobilitätsbedürfnis und Budget
Ein unabhängiger Kfz-Gutachter ermittelt objektiv:
- Reparaturkosten netto/brutto
- Wiederbeschaffungswert
- Restwert
- Wertminderung
Erst dann kann eine fundierte Entscheidung getroffen werden.
Beispiel:
- Reparaturkosten: 6.800 €
- Wiederbeschaffungswert: 5.800 €
- 130%-Grenze: 7.540 € → Reparatur ist rechtlich noch zulässig
Was ist ein wirtschaftlicher Totalschaden?
Ein wirtschaftlicher Totalschaden liegt vor, wenn die Reparaturkosten den Wiederbeschaffungswert übersteigen.
Begriffsklärung:
- Wiederbeschaffungswert (WBW): Was Ihr Auto vor dem Unfall auf dem regionalen Markt wert war
- Reparaturkosten (RK): Die netto berechneten Kosten einer fachgerechten Instandsetzung
- Restwert (RW): Was Ihr beschädigtes Fahrzeug noch auf dem Markt bringt
Formel: Wenn RK > WBW → wirtschaftlicher Totalschaden
Wichtig: Es handelt sich nicht um einen technischen Totalschaden (wo das Fahrzeug nicht mehr reparabel ist), sondern um eine wirtschaftliche Abwägung.
Die 130%-Regel im Detail
Die sogenannte 130%-Regelung (BGH-Rechtsprechung) erlaubt es Ihnen, ein Fahrzeug trotz wirtschaftlichem Totalschaden zu reparieren, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
Voraussetzungen:
- Reparaturkosten betragen maximal 130% des WBW
- Die Reparatur erfolgt fachgerecht und vollständig (belegbar durch Rechnung)
- Das Fahrzeug wird mindestens 6 Monate weiter genutzt
Beispielrechnung:
- Wiederbeschaffungswert: 5.000 €
- Maximaler Reparaturwert gem. 130%-Regel: 6.500 €
Ablauf:
- Sie lassen das Fahrzeug reparieren
- Reichen die Reparaturrechnung bei der Versicherung ein
- Nutzen das Fahrzeug für mind. 6 Monate weiter (ggf. mit eidesstattlicher Versicherung)
Achtung: Bei nur teilweiser oder unsachgemäßer Reparatur verfällt die 130%-Regel.
Der Restwert: Was das Auto noch “wert” ist
Der Restwert ist der Betrag, den ein Händler oder Verwerter noch für Ihr beschädigtes Fahrzeug zahlen würde. Er wird vom Gutachter auf Basis regionaler und überregionaler Restwertbörsen ermittelt.
Beispiel:
- Wiederbeschaffungswert: 7.000 €
- Reparaturkosten: 7.500 €
- Restwert: 2.500 €
Sie erhalten dann: 7.000 € – 2.500 € = 4.500 € von der Versicherung (wenn Sie das Auto nicht reparieren)
Tipp: Sie müssen nicht das höchste Online-Angebot annehmen, das Ihnen die Versicherung nennt, sondern dürfen den im Gutachten genannten Wert als Basis nehmen, solange Sie das Auto nicht verkaufen.
Verkauf eines Unfallwagens: Chancen, Risiken, Preise
Wenn Sie sich gegen eine Reparatur entscheiden, steht der Verkauf des beschädigten Fahrzeugs an. Dabei gilt es einige Fallstricke zu vermeiden.
Optionen:
- Verkauf an einen Händler (Restwertangebot)
- Privatverkauf (“wie gesehen”)
- Export ins Ausland (auf eigene Verantwortung)
Wichtig:
- Den Unfall immer angeben (auch bei reparierten Fahrzeugen)
- Alle relevanten Unterlagen beilegen (Gutachten, Fotos, Schadensbericht)
- Restwertangebote dokumentieren (zum Beweis gegenüber der Versicherung)
Preiseinschätzung:
- Bei repariertem Unfallfahrzeug: bis zu 25% Preisabschlag
- Bei unrepariertem Schaden: Preis meist unterhalb des Restwertes
Tipp: Verkaufen Sie nie unter Druck. Lassen Sie sich Zeit für Angebote. Nutzen Sie Vergleichsportale, aber achten Sie auf Seriosität.
Reparaturrechnung oder fiktive Abrechnung?
Sie haben die Wahl: Reparieren oder sich den Schaden auszahlen lassen.
a) Reparatur mit Rechnung
- Sie lassen in einer Werkstatt reparieren
- Reichen die Originalrechnung ein
- Bekommen den vollen Bruttobetrag inkl. Mehrwertsteuer
b) Fiktive Abrechnung
- Sie verzichten auf Reparatur oder reparieren selbst
- Die Versicherung zahlt den netto kalkulierten Betrag aus dem Gutachten
Vorteile der fiktiven Abrechnung:
- Flexibilität (Sie entscheiden über Zeitpunkt oder Reparaturumfang)
- Sie können mit dem Geld anderweitig wirtschaften
Einschränkungen:
- Keine MwSt. auf Ersatzteile ohne Rechnung
- Keine Erstattung für nicht nachgewiesene Positionen (z. B. Lackierung)
- Bei Teilschuld oder Mitverschulden: Kürzungen möglich
Werkstattwahl: Muss ich zur Partnerwerkstatt der Versicherung?
Klare Antwort: Nein. Sie haben freie Werkstattwahl. Das gilt auch dann, wenn die gegnerische Versicherung Ihnen eine “Partnerwerkstatt” empfiehlt.
Achtung bei eigener Vollkasko:
- In vielen Verträgen ist eine Werkstattbindung vereinbart
- Dann müssen Sie zur Partnerwerkstatt oder bekommen nur reduzierte Leistungen
Bei Haftpflichtschaden (also unverschuldet):
- keine Werkstattbindung
- Sie dürfen die Werkstatt frei wählen
- Auch freie Werkstätten sind zulässig
Tipp: Lassen Sie sich nicht einschüchtern von Aussagen wie “Wir übernehmen nur die Kosten, wenn Sie zu unserer Werkstatt gehen”. Diese sind unzulässig.
Bagatellschaden oder nicht?
Ein “Bagatellschaden” liegt nach Rechtsprechung des BGH nur bei sehr kleinen Schäden vor (unter ca. 750 €).
Typisch:
- Leichte Kratzer, kleine Dellen, abgeplatzter Lack
Nicht bagatellhaft:
- Beulen, Beschädigungen an Scheinwerfern, Blechteilen, Sensoren
Folge:
- Bei Bagatellschäden reicht ein Kostenvoranschlag
- Bei höherem Schaden: Anspruch auf vollständiges Gutachten
Tipp: Lassen Sie die Bagatellgrenze immer von einem Gutachter beurteilen, nicht von der Versicherung.
Reparatur in Eigenregie: erlaubt, aber nicht immer sinnvoll
Sie dürfen Ihr Fahrzeug nach fiktiver Abrechnung selbst reparieren. Allerdings gibt es Fallstricke:
Beispiele:
- Keine MwSt.-Erstattung ohne Rechnung
- Keine Prüfung auf sicherheitsrelevante Mängel
- Bei Wiederverkauf: Offenlegungspflicht der Eigenreparatur
Tipp: Führen Sie eine Fotodokumentation durch, wenn Sie selbst reparieren (z. B. bei Stoßstangenwechsel).
Vorsicht bei Leasingfahrzeugen: Eigenreparatur ist hier in der Regel nicht erlaubt.
Nutzungsausfall oder Mietwagen – was steht mir zu?
Wenn Sie nach dem Unfall auf Ihr Fahrzeug verzichten müssen, haben Sie Anspruch auf Mobilitätsentschädigung:
a) Nutzungsausfall
- Pauschalbetrag pro Tag (je nach Fahrzeugklasse)
- Nach Schwacke-Tabelle: ca. 29 € bis 99 €/Tag
- Voraussetzung: Reparaturdauer oder Wiederbeschaffungszeit
b) Mietwagen
- Anspruch besteht für die tatsächlich benötigte Dauer
- Versicherung zahlt nur “erforderliche” Kosten
- Mietwagenklasse muss Fahrzeug entsprechen
Tipp: Nutzungsausfall lohnt sich, wenn Sie auf einen Mietwagen verzichten können – und ist unbürokratischer.
Besonderheiten bei Leasing-, E- und Firmenfahrzeugen
Leasingfahrzeuge:
- Eigentümer ist die Leasinggesellschaft
- Sie als Fahrer müssen Reparaturen und Gutachten abstimmen
- Viele Leasinggeber bestehen auf Reparatur in Vertragswerkstatt
E-Fahrzeuge:
- Hochvoltsysteme erfordern Spezialwerkstätten
- Reparaturkosten oft höher (z. B. Batteriewechsel)
- Achtung bei Sensorik und Software
Firmenwagen:
- Haftung des Arbeitgebers, wenn dienstlich unterwegs
- Bei grober Fahrlässigkeit: Eigenbeteiligung möglich
- Dokumentation und Meldung an Fuhrparkleitung wichtig
Tipp: Bei Sonderfahrzeugen immer frühzeitig Anwalt und Gutachter hinzuziehen, um keine Rechte zu verlieren.
Fazit: Unfallregulierung klug steuern – so bleiben Sie in Kontrolle
Ein Unfall bringt nicht nur Blechschaden mit sich, sondern komplexe Entscheidungen rund ums Fahrzeug. Zwischen Reparatur, Restwert, Werkstattbindung und Abrechnungsarten können Laien schnell den Überblick verlieren.
Deshalb unser Rat:
- Unabhängigen Gutachter beauftragen
- Anwalt einschalten, um Ihre Ansprüche durchzusetzen
- Nicht vorschnell entscheiden, z. B. bei Verkauf oder Reparatur
- Selbstbestimmt handeln und nicht auf Vorschläge der Versicherung vertrauen
Ein Unfall muss kein Nachteil für Sie sein – wenn Sie Ihre Rechte kennen und nutzen.