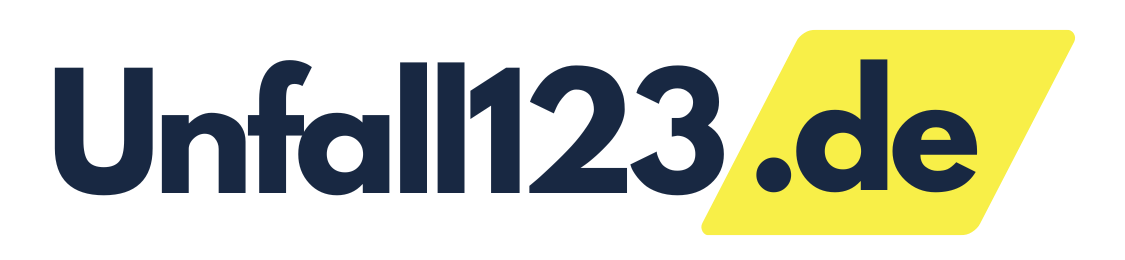Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Ein Verkehrsunfall ist schon stressig genug – umso wichtiger ist es, bei der Schadenregulierung alle Möglichkeiten zu kennen. Viele Privatpersonen fragen sich, ob sie den Unfallschaden auszahlen lassen können, anstatt das Fahrzeug reparieren zu lassen. Diese Option nennt sich fiktive Abrechnung und kann in Deutschland bei Haftpflichtschäden in Anspruch genommen werden. In diesem Ratgeber von Unfall123.de erfahren Sie verständlich und Schritt für Schritt, was die fiktive Abrechnung bedeutet, welche Rechte und Pflichten Sie haben und wie Sie dabei am besten vorgehen. Außerdem zeigen wir, welche Kosten Ihnen erstattet werden, worauf Versicherungen oft achten und wie Unfall123.de Sie bei der Abwicklung unterstützen kann.
Definition und rechtlicher Rahmen
Unter einer fiktiven Schadensabrechnung (auch Abrechnung auf Gutachtenbasis genannt) versteht man die Regulierung eines Unfallschadens ohne tatsächliche Reparatur des Fahrzeugs. Anstatt die Werkstattkosten gegen Rechnung zu begleichen, lässt sich der Geschädigte den Schaden in Geld auszahlen. Rechtlich ist dies durch § 249 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) gedeckt, der dem Geschädigten das Wahlrecht einräumt, statt der Wiederherstellung den erforderlichen Geldbetrag zu verlangen. Mit anderen Worten: Sie müssen Ihr Fahrzeug nach einem unverschuldeten Unfall nicht reparieren lassen, sondern können von der gegnerischen Versicherung den Betrag einfordern, der für die Reparatur nötig wäre. Die Schadenabrechnung erfolgt dann auf Grundlage eines Sachverständigengutachtens oder Kostenvoranschlags, ohne dass das Fahrzeug in die Werkstatt muss. Wichtig zu wissen: Entscheiden Sie sich für die fiktive Abrechnung, erhalten Sie die im Gutachten kalkulierten Reparaturkosten nur netto, also ohne Mehrwertsteuer. Dieser Abzug der Umsatzsteuer ist gesetzlich vorgeschrieben (§ 249 Abs. 2 Satz 2 BGB), solange die Reparatur nicht tatsächlich durchgeführt wurde.
Der rechtliche Rahmen sieht außerdem vor, dass die Versicherung des Unfallverursachers alle erforderlichen Kosten übernehmen muss, um den Zustand wie vor dem Unfall wiederherzustellen. Dazu zählen im Haftpflichtfall neben den reinen Reparaturkosten z.B. auch Gutachterkosten, Wertminderung, Nutzungsausfall und Anwaltskosten (Details zu diesen Posten folgen später). Der Geschädigte hat grundsätzlich Dispositionsfreiheit, d.h. er darf selbst entscheiden, ob, wann und wie er repariert. Diese Freiheit ist nur durch das Wirtschaftlichkeitsgebot begrenzt: Der Schadenersatz darf nicht zur Bereicherung führen, und es muss eine wirtschaftlich vernünftige Lösung gewählt werden. In der Praxis bedeutet das z.B., dass die Versicherung unter gewissen Umständen auf eine günstigere Reparaturmöglichkeit verweisen darf, um überhöhte Kosten zu vermeiden (siehe Abschnitt „Häufige Probleme mit Versicherern“). Insgesamt ist die fiktive Abrechnung aber ein etabliertes Recht im Verkehrsrecht, das Unfallopfern eine Alternative zur sofortigen Reparatur bietet und vom Bundesgerichtshof in mehreren Urteilen bestätigt wurde.
Voraussetzungen für die fiktive Abrechnung
Grundsätzlich kann jeder unverschuldet Unfallgeschädigte in Deutschland eine fiktive Abrechnung wählen, sofern es sich um einen Haftpflichtschaden handelt – also der Unfallgegner (bzw. dessen Kfz-Haftpflichtversicherung) für den Schaden aufkommen muss. Bei einem selbst verschuldeten Unfall (eigene Vollkaskoversicherung) gelten andere Regeln; viele Kaskoversicherungen schließen die fiktive Abrechnung aus oder schränken sie ein. Wir konzentrieren uns hier auf den üblichen Fall eines gegnerischen Haftpflichtschadens bei Privatpersonen.
Wichtigste Voraussetzung ist, dass die Schadenhöhe objektiv nachgewiesen wird. Die gegnerische Versicherung zahlt nicht „auf Zuruf“ einen beliebigen Betrag aus. Sie benötigen also entweder einen qualifizierten Kostenvoranschlag einer Werkstatt oder – bei größeren Schäden – ein Sachverständigengutachten, das den Reparaturaufwand beziffert. In der Praxis hat sich folgende Faustregel etabliert: Bei Bagatellschäden (sehr kleinen Schäden) mit Reparaturkosten bis etwa 750–1.000 € reicht meist ein Kostenvoranschlag plus Fotos aus. Ein teures Gutachten wäre in solchen Fällen unwirtschaftlich, da die Versicherung die Gutachterkosten möglicherweise nicht übernimmt. Übersteigen die Schäden jedoch diese Bagatellgrenze oder besteht der Verdacht auf einen wirtschaftlichen Totalschaden, sollten Sie unbedingt ein unabhängiges Gutachten einholen. Ein Gutachten liefert eine verlässliche Kalkulation und enthält weitere wichtige Angaben (z.B. Wiederbeschaffungswert, Restwert, Reparaturdauer), die für die Abrechnung relevant sind.
Eine weitere Voraussetzung ist natürlich, dass dem Grunde nach ein Schadensersatzanspruch besteht. Das heißt, die Haftungsfrage sollte geklärt sein – idealerweise hat der Unfallgegner die Schuld anerkannt oder die Polizei hat ein Protokoll aufgenommen, aus dem hervorgeht, wer verantwortlich ist. Solange die Haftung noch strittig ist, wird die gegnerische Versicherung nicht regulieren. In klaren Fällen (z.B. Ihnen fährt jemand aufs stehende Auto auf) steht einer fiktiven Abrechnung aber nichts im Wege. Selbst wenn eine Mitschuld Ihrerseits vorliegt, können Sie fiktiv abrechnen – die Versicherung zahlt dann entsprechend der Haftungsquote einen Anteil Ihres Schadens.
Zusammengefasst benötigen Sie für die fiktive Abrechnung also:
- Einen unverschuldeten Kfz-Unfall (Haftpflichtfall) mit Schaden an Ihrem Fahrzeug.
- Einen Kostenvoranschlag oder Gutachten als Nachweis der Schadenhöhe (bei größeren Schäden unbedingt Gutachten).
- Die Bereitschaft, den Schaden vorerst nicht reparieren zu lassen, sondern die Auszahlung zu wählen.
- Eine klare Haftungslage und Meldung des Schadens an die gegnerische Versicherung (direkt, über einen Anwalt oder Dienstleister).
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, können Sie gegenüber der Versicherung des Unfallgegners offiziell eine fiktive Abrechnung beantragen bzw. Ihre Schadenforderungen auf Gutachtenbasis stellen. Wie das genau abläuft, erläutern wir in der Schritt-für-Schritt-Anleitung weiter unten.
Reparaturkosten vs. Wiederbeschaffungswert
Ein zentraler Aspekt bei der Schadenregulierung ist die Frage, ob ein Fahrzeug wirtschaftlich reparierbar ist oder ob ein Totalschaden vorliegt. Daher sollte man die Begriffe Reparaturkosten und Wiederbeschaffungswert verstehen:
- Reparaturkosten: Das ist der Betrag, den eine fachgerechte Reparatur des Fahrzeugs kosten würde. Im Gutachten werden die Reparaturkosten netto und brutto (inkl. MwSt.) angegeben. Bei fiktiver Abrechnung dient typischerweise der Nettobetrag als Grundlage, da keine MwSt. erstattet wird.
- Wiederbeschaffungswert: Das ist der geschätzte Marktwert Ihres Fahrzeugs unmittelbar vor dem Unfall. Er entspricht den Kosten, um ein gleichwertiges Fahrzeug zu beschaffen (Alter, Modell, Ausstattung, Zustand). Dieser Wert wird vom Sachverständigen ermittelt und im Gutachten angegeben.
Wirtschaftlicher Totalschaden liegt vor, wenn die Reparaturkosten den Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs übersteigen. In diesem Fall wäre eine Reparatur ökonomisch unsinnig, da sie teurer ist als ein Ersatzfahrzeug. Die Versicherung rechnet dann in aller Regel auf Totalschadenbasis ab, d.h. Sie erhalten den Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert ausgezahlt. Der Restwert ist der Betrag, den Sie für das beschädigte Fahrzeug im unreparierten Zustand noch erlösen können (z.B. durch Verkauf an einen Restwertaufkäufer oder Verwertung). Auch dieser wird im Gutachten ausgewiesen. Ihre Entschädigung berechnet sich also: Wiederbeschaffungswert – Restwert = Auszahlungssumme. Sie haben dann die Wahl, das kaputte Auto zu diesem Restwert zu verkaufen oder es zu behalten (behalten Sie es, haben Sie quasi den Restwert in Form des verbleibenden Fahrzeugs). Die Versicherung zahlt in jedem Fall nur die Differenz.
Ein Beispiel: Hat Ihr Wagen vor dem Unfall einen Wiederbeschaffungswert von 8.000 € und das Gutachten kalkuliert Reparaturkosten von 10.000 €, liegt ein wirtschaftlicher Totalschaden vor. Ist der Restwert z.B. 2.000 €, bekommen Sie von der Versicherung 6.000 € ausgezahlt. Die 2.000 € könnten Sie durch Verkauf des Wracks zusätzlich erzielen, um sich wieder ein gleichwertiges Auto für 8.000 € anschaffen zu können.
130%-Regel: Eine wichtige Besonderheit im deutschen Schadensrecht ist die sogenannte 130%-Regel. Sie besagt, dass ein Geschädigter ausnahmsweise trotzdem die vollen Reparaturkosten erstattet bekommen kann, obwohl sie den Wiederbeschaffungswert übersteigen – allerdings maximal bis 130% des Wiederbeschaffungswerts. Voraussetzungen dafür sind: Die Reparaturkosten liegen höchstens 30% über dem Wiederbeschaffungswert, das Fahrzeug wird tatsächlich und fachgerecht repariert (nach Vorgaben des Gutachtens) und der Geschädigte nutzt das Fahrzeug anschließend noch mindestens 6 Monate weiter. In so einem Fall würde die Versicherung also z.B. Reparaturkosten von 10.400 € übernehmen, obwohl der Wagen nur 8.000 € wert war (130% von 8.000 €). Achtung: Diese 130%-Regel greift nur bei konkreter Abrechnung, also wenn Sie wirklich reparieren lassen und die Bedingungen erfüllen. Ohne Reparatur (fiktiv) können Sie nicht mehr als den Wiederbeschaffungswert geltend machen. In der fiktiven Abrechnung wird bei wirtschaftlichem Totalschaden also immer auf die günstigere Lösung abgestellt: Entweder die (Netto-)Reparaturkosten, falls sie unter dem Wiederbeschaffungswert liegen, oder der Wiederbeschaffungswert minus Restwert, falls ein Totalschaden vorliegt.
Kurz gesagt: Liegt kein Totalschaden vor, können Sie fiktiv die netto Reparaturkosten bis maximal zum Wiederbeschaffungswert erstattet bekommen. Liegt ein Totalschaden vor, erhalten Sie nur den Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert als Entschädigung – eine Reparatur wird dann von der Versicherung nicht finanziert, es sei denn, Sie reparieren tatsächlich auf eigene Faust (130%-Regel). In jedem Fall stellt das Gutachten alle benötigten Zahlen bereit, um dies zu beurteilen.
Rolle des Gutachtens (Sachverständiger)
Ein unabhängiges Schadengutachten spielt bei der fiktiven Abrechnung oft eine entscheidende Rolle. Der Kfz-Sachverständige (Gutachter) dokumentiert den Unfallschaden und ermittelt objektiv folgende Punkte:
- die Reparaturkosten (Arbeitszeit, Ersatzteile, Lackierung etc.), netto und brutto,
- die voraussichtliche Reparaturdauer (Anzahl Tage in der Werkstatt),
- den Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs vor dem Unfall,
- den Restwert des beschädigten Fahrzeugs,
- eine eventuell anfallende merkantile Wertminderung (dazu später mehr),
- sowie weitere Befunde (Vorschäden, fehlende Wartung, Zustand des Autos).
Diese Informationen sind nicht nur für Sie, sondern auch für die Versicherung Grundlage der Regulierung. Gerade wenn Sie fiktiv abrechnen wollen, ist das Gutachten quasi Ihr „Trumpf“: Es ersetzt die Reparaturrechnung als Beleg für die Schadenhöhe. „Wer sich den Schaden auszahlen lässt, bekommt die Reparaturkosten gemäß Gutachten oder Kostenvoranschlag, allerdings ohne Mehrwertsteuer.“ erinnert der ADAC treffend. Ohne Gutachten (bzw. bei kleinen Schäden ein Kostenvoranschlag) wüssten Sie gar nicht, welchen Betrag Sie fordern können.
Daher gilt: Bei allen Schäden, die nicht nur minimale Kratzer sind, sollten Sie einen Sachverständigen einschalten. Bei Bagatellen unter ~750 € reicht ein Kostenvoranschlag, aber ab ca. 1.000 € Schadenhöhe ist ein Gutachten ratsam. Sie haben als Geschädigter das Recht, einen Gutachter Ihres Vertrauens zu beauftragen – es muss nicht der von der Versicherung empfohlene oder geschickte Gutachter sein. Im Gegenteil, es ist oft besser, einen unabhängigen Sachverständigen zu wählen, der in Ihrem Interesse handelt. Die Kosten des Gutachtens muss die gegnerische Versicherung erstatten, sofern das Gutachten erforderlich war (bei größeren Schäden ist es das). Beachten Sie: Lassen Sie bei einem winzigen Schaden unnötigerweise ein teures Gutachten anfertigen, bleiben Sie evtl. auf den Gutachterkosten sitzen. Orientieren Sie sich also an der genannten Bagatellgrenze.
Ein weiterer Vorteil eines Gutachtens: Der Sachverständige dokumentiert den Schaden detailliert mit Fotos und Beschreibung. Dadurch sind alle unfallbedingten Beschädigungen erfasst, und es wird vermieden, dass die Versicherung später Teile des Schadens als „vorher schon vorhanden“ abtut. (Die Versicherung wird nämlich prüfen, ob im Gutachten nicht doch Vorschäden mit aufgeführt wurden.) Ein gutes Gutachten trennt daher klar zwischen Altschäden und Unfallfolgen.
Zusätzlich enthält ein Gutachten oft die kalkulierte Nutzungsausfallentschädigung (eine Tabelle gibt an, wie viele Euro pro Tag Ihnen zustehen würden, falls Sie keinen Mietwagen nehmen). Auch das kann später wichtig sein, wenn Sie Nutzungsausfall geltend machen wollen.
Zusammengefasst: Das Gutachten liefert die objektive Basis für Ihre Forderung. Sie reichen es bei der Versicherung ein und verlangen die Begleichung der darin aufgeführten Kosten (mit den Einschränkungen, die wir noch erläutern). Ohne Gutachten wüssten weder Sie noch der Versicherer genau, wie hoch der Schaden wirklich ist. Es ist also das A und O einer erfolgreichen fiktiven Abrechnung, einen seriösen Kfz-Sachverständigen einzuschalten (z.B. vermittelt unfall123.de passende Gutachter).
Erstattungsfähige Kosten
Entscheiden Sie sich für die fiktive Abrechnung, können verschiedene Schadenspositionen geltend gemacht werden – also nicht nur der Blechschaden an sich. Im Folgenden erläutern wir, welche Kosten die gegnerische Versicherung im Haftpflichtfall ersetzen muss, selbst wenn Sie nicht reparieren, und was es dabei zu beachten gibt.
Nutzungsausfall und Mietwagen
Wenn Ihr Auto unfallbedingt ausfällt, haben Sie Anspruch auf Ersatz der Nutzungsmöglichkeit. Das erfolgt entweder durch Gestellung eines Mietwagens oder durch Auszahlung einer Nutzungsausfallentschädigung pro Tag. Bei konkreter Reparatur ist das relativ einfach: Für die Dauer der Werkstattreparatur steht Ihnen entweder ein Mietwagen vergleichbarer Klasse zu oder ein pauschaler Betrag pro Ausfalltag (je nach Fahrzeugtyp, z.B. 35 € pro Tag). Aber wie ist das bei fiktiver Abrechnung, wo keine tatsächliche Reparatur in der Werkstatt stattfindet?
Nutzungsausfallentschädigung: Prinzipiell kann auch bei fiktiver Abrechnung eine Nutzungsausfallpauschale verlangt werden. Allerdings sind Versicherer hier oft skeptisch. Die Rechtsprechung verlangt gewisse Nachweise: In der Regel wird vorausgesetzt, dass das Fahrzeug tatsächlich repariert wurde – zumindest in Eigenregie – und für einen gewissen Zeitraum nicht zur Verfügung stand. Praktisch bedeutet das: Sie können den Nutzungsausfall meist nur dann fiktiv abrechnen, wenn Sie den Schaden selbst (oder privat) repariert haben und dies belegen können (z.B. mit Fotos vom reparierten Fahrzeug und einer tagesaktuellen Zeitung als Datumsnachweis). Die entschädigungsfähige Ausfallzeit orientiert sich an der im Gutachten geschätzten Reparaturdauer, z.B. 5 Tage. Haben Sie gar nichts repariert und Ihr Auto war durch den Schaden weiterhin fahrbereit, tun sich Versicherer schwer, einen Nutzungsausfall zu zahlen – schließlich konnten Sie das Auto ja nutzen. Ohne Reparaturnachweis wird Nutzungsausfall oft abgelehnt. Rechtlich umstritten war lange, ob Nutzungsausfall rein fiktiv verlangt werden kann. Einige Gerichte bejahen dies unter bestimmten Umständen (z.B. LG Saarbrücken: fiktiver Nutzungsausfall ist möglich, wenn die Reparatur objektiv in X Tagen machbar gewesen wäre). In der Praxis sollten Sie jedoch damit rechnen, dass die Versicherung einen Nachweis verlangt. Im Totalschadenfall ist es ähnlich: Nutzungsausfall gibt es normalerweise nur, wenn Sie die Anschaffung eines Ersatzfahrzeugs nachweisen (Kaufvertrag), da man andernfalls annimmt, Sie hätten keinen „Nutzungswillen“ mehr.
Mietwagen: Bei der fiktiven Abrechnung werden Mietwagenkosten in aller Regel nicht erstattet, sofern keine tatsächliche Reparatur stattfindet. Denn ein Mietwagen wird typischerweise gestellt, während Ihr eigenes Auto in der Werkstatt repariert wird. Wenn Sie aber gar nicht reparieren lassen, entfällt die Grundlage für einen Werkstatt-Ersatzwagen. Die Versicherer handhaben es so: Ohne Reparaturnachweis kein Mietwagenersatz. Sollten Sie dennoch einen Mietwagen genommen haben, könnten Sie Schwierigkeiten bekommen, diese Kosten ersetzt zu bekommen – es sei denn, Ihr Fahrzeug war nicht fahrbereit und Sie haben zeitnah ein Ersatzfahrzeug beschafft. In Totalschadenfällen werden Mietwagenkosten für die im Gutachten angegebene Wiederbeschaffungsdauer bezahlt (z.B. 14 Tage), aber auch hier nur bei Nachweis der Ersatzbeschaffung.
Fazit: Nutzungsausfall ist grundsätzlich erstattungsfähig (auch fiktiv), aber ohne tatsächliche Instandsetzung wird die Versicherung nicht ohne Weiteres zahlen wollen. Wenn Sie also fiktiv abrechnen und trotzdem einen Nutzungsausfall beanspruchen möchten, sollten Sie entweder zumindest eine Teilreparatur durchführen oder gut begründen können, warum Ihr Wagen nicht nutzbar war. Ein Mietwagen auf Kosten der Versicherung steht fiktiv in der Regel nicht zur Verfügung, außer Sie reparieren doch noch konkret (dann wäre es ja keine rein fiktive Abrechnung mehr). Im Zweifel lassen Sie sich hierzu anwaltlich beraten. Oft ist es vernünftiger, statt eines Mietwagens die Nutzungsausfallpauschale zu nehmen, da hier kein strenger Nachweis einer „wirtschaftlichen“ Anmietung geführt werden muss. Die Höhe der Nutzungsausfallentschädigung pro Tag richtet sich nach Tabellen (Schwacke-Liste) und hängt von Fahrzeugtyp und Alter ab – dieser Wert wird im Gutachten genannt oder kann vom Sachverständigen ermittelt werden.
Gutachterkosten
Die Kosten für den Kfz-Sachverständigen (Gutachterkosten) gehören bei einem unverschuldeten Unfall zum erstattungsfähigen Schaden dazu, sofern die Einschaltung eines Gutachters erforderlich und zweckmäßig war. In einem Haftpflichtfall muss der Schädiger (bzw. seine Versicherung) alle durch den Unfall verursachten Kosten tragen – und dazu zählt auch die sachkundige Feststellung des Schadensumfangs. Typischerweise zahlt die gegnerische Versicherung das Gutachten, wenn es sich nicht gerade um einen Bagatellschaden handelte. Wie erwähnt, sollten Sie bei sehr kleinen Schäden erst Rücksprache halten, ob ein Gutachten nötig ist, um nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben.
Praktisch läuft es so: Sie beauftragen den Gutachter. Dieser stellt Ihnen seine Kosten in Rechnung (oft einige Hundert Euro, je nach Schadenhöhe). Diese Rechnung reichen Sie mit bei der Versicherung ein. Im Idealfall überweist die Versicherung später neben der Schadensumme auch die Gutachterkosten auf Ihr Konto. Sollte die Versicherung die Gutachterkosten unbegründet ablehnen, können Sie diese notfalls gerichtlich mit einklagen – in aller Regel passiert das aber nicht, wenn der Schaden offensichtlich über der Bagatellgrenze lag. Wichtig: Behalten Sie Kopien aller Unterlagen. Manche Versicherer zahlen aus, verlangen aber das Originalgutachten für ihre Unterlagen. Lassen Sie sich immer Kopien zurückgeben, falls Sie Originale einschicken müssen.
Hinweis: Im Kaskofall (eigene Vollkasko) ist die Übernahme von Gutachterkosten oft nicht vorgesehen, außer der Versicherer selbst beauftragt den Gutachter. Bei Haftpflichtschäden jedoch ist der Gutachter ein Teil der Schadenminderungspflicht – Sie als Geschädigter dürfen einen Gutachter nehmen, um Ihren Schaden korrekt zu beziffern. Diese Kosten gelten als notwendiger Aufwand, den der Schädiger ersetzen muss.
Merkantiler Minderwert
Der Begriff merkantiler Minderwert bezeichnet die Wertminderung Ihres Fahrzeugs infolge des Unfalls, selbst nach einer fachgerechten Reparatur. Viele Käufer zahlen für ein Unfallfahrzeug (auch wenn es repariert wurde) weniger, da Unfälle einen „Makel“ darstellen. Diese dauerhafte Wertminderung – z.B. durch einen verzogenen Rahmen oder einfach den Unfaller-Status im Fahrzeugbrief – wird als Schadenposition anerkannt, vor allem bei neueren Fahrzeugen (meist bis ~5 Jahre alt und < 100.000 km Laufleistung). Der Gutachter beziffert diesen Minderwert in Euro, falls er der Meinung ist, dass einer vorliegt.
Auch bei fiktiver Abrechnung haben Sie Anspruch auf Ersatz der merkantilen Wertminderung. Es kommt dabei nicht darauf an, ob Sie reparieren oder nicht – entscheidend ist, dass Ihr Fahrzeug durch den Unfall einen bleibenden Wertverlust erlitten hat. Die Versicherung muss diesen Wertverlust ersetzen, da er Teil des gesamten Schadens ist. So hat z.B. das OLG Köln 2023 klargestellt, dass Wertminderung auch bei fiktiver Abrechnung zu zahlen ist. In der Praxis wird die im Gutachten ausgewiesene Wertminderungssumme Ihnen zusätzlich ausgezahlt. Voraussetzung ist allerdings, dass Ihr Wagen überhaupt jung/hochwertig genug ist, damit ein Minderwert angesetzt wird. Bei älteren Autos (älter als ~5 Jahre) oder sehr geringen Schäden setzen Gutachter oft keinen Minderwert an, weil Käufer durch den Vorschaden keinen spürbar niedrigeren Preis zahlen würden.
Beispiel: Ihr 3 Jahre altes Auto (Wert 20.000 €) hatte einen erheblichen Seitenschaden. Trotz Reparatur würde es als „Unfallwagen“ vielleicht nur noch für 18.500 € verkauft werden können, statt für 19.500 € ohne Unfall. Diese 1.000 € Differenz wären der merkantile Minderwert, den der Gutachter als Schadenposition ansetzt. Die Versicherung müsste Ihnen diese 1.000 € ersetzen – auch wenn Sie fiktiv abrechnen und gar nicht reparieren, denn der Minderwert tritt in gewisser Weise schon durch den Unfallschaden an sich ein. Beachten Sie: Wenn Sie nicht reparieren, ist Ihr Fahrzeug natürlich vorerst mehr als nur „merkantil“ gemindert – es hat dann einen direkten Schaden. Dieser direkte Wertverlust entspricht im Wesentlichen den Reparaturkosten (weshalb Sie diese ja ausgezahlt bekommen). Die merkantile Wertminderung kommt vor allem zum Tragen, falls Sie reparieren würden. Daher ist sie in der fiktiven Abrechnung ein separater Posten, den Sie zusätzlich erhalten, sofern im Gutachten ausgewiesen.
Weitere ersetzbare Schadensposten
Neben den Hauptposten (Reparaturkosten, Wertminderung, Nutzungsausfall, Gutachter) gibt es noch weitere Kosten, die Ihnen entstanden sein können und die der Versicherer im Haftpflichtfall ersetzen muss. Dazu zählen zum Beispiel:
- Abschleppkosten: Musste Ihr Fahrzeug nach dem Unfall abgeschleppt werden (weil es z.B. nicht mehr fahrbereit war), sind die Kosten für den Abschleppdienst erstattungsfähig. Gleiches gilt für Bergungskosten.
- Standgebühren: Falls Ihr Auto vorübergehend auf einem Abschlepphof oder in einer Werkstatt eingestellt wurde, können angemessene Standgebühren übernommen werden (wird meist mit der Versicherung abgestimmt).
- Fahrzeugbergung/Entsorgung: Bei Totalschaden erstattet die Versicherung auch die Kosten für die Entsorgung des Fahrzeugs bzw. die Verwertung, sofern sie anfallen.
- Kennzeichen und Anmeldung: Ebenfalls bei Totalschaden werden Zulassungskosten für ein Ersatzfahrzeug und neue Kennzeichen ersetzt.
- Unkostenpauschale: Nahezu alle Versicherer zahlen eine kleine Pauschale für Telefonate, Porto und sonstigen Aufwand des Geschädigten. Diese Kostenpauschale liegt meist bei 20–30 €. Sie wird normalerweise ohne Nachweis gezahlt, da man davon ausgeht, dass Ihnen durch die Unfallabwicklung solche Kleinausgaben entstehen.
- Anwaltskosten: Beauftragen Sie aufgrund des Unfalls einen Rechtsanwalt, muss die gegnerische Versicherung dessen Kosten übernehmen (entsprechend der Haftungsquote). Gerade bei strittigen oder größeren Schäden ist dies ratsam – und im Haftpflichtfall für Sie praktisch kostenlos, denn der Versicherer trägt die Anwaltsrechnung. (Als Laie kann man viele Fallstricke vermeiden, indem man frühzeitig einen Anwalt einschaltet – siehe „Tipps“ weiter unten.)
- Sonstige Sachschäden: Wurden bei dem Unfall noch andere Gegenstände beschädigt, z.B. Ihr Handy, eine Brille, Kleidung oder der Kindersitz im Auto, so können auch diese Schäden geltend gemacht werden. Sie sollten solche Posten mit Fotos und möglichst Rechnungen belegen. Die Versicherung wird sie erstatten, sofern die Kausalität zum Unfall klar ist.
All diese genannten Positionen sind unabhängig von der Frage, ob Sie reparieren lassen oder nicht. Sie gehören zum umfangreichen Schadenersatz, den Sie nach deutschem Recht verlangen können. Achten Sie also darauf, keinen Posten zu vergessen. Die Versicherung wird von sich aus selten auf Sie zukommen und z.B. nachfragen, ob Ihr Kindersitz kaputt ging. Sie müssen die einzelnen Ansprüche schon anziehen (geltend machen). Eine vollständige Liste aller entstandenen Kosten im Anschreiben an die Versicherung ist daher sinnvoll. Der ADAC empfiehlt z.B. darauf hinzuweisen, dass auch Wertminderung, Abschleppkosten, Pauschale usw. verlangt werdenadac.de.
Nicht ersetzte Kosten
Im Rahmen der fiktiven Abrechnung gibt es auch ein paar Kostenpunkte, die nicht erstattet werden. Damit Sie keine bösen Überraschungen erleben, sollten Sie diese Punkte kennen:
- Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer): Wie bereits erwähnt, wird die MwSt. auf Reparaturkosten nicht gezahlt, solange Sie den Schaden nicht tatsächlich (gegen Rechnung) reparieren lassen. Sie erhalten also stets nur Netto-Beträge. Dies gilt sogar dann, wenn Sie irgendwann später doch reparieren – die Versicherung zahlt die Steuer erst nachträglich gegen Vorlage der Rechnung. Wenn Sie gar nicht reparieren, bleibt die MwSt. endgültig bei Ihnen unersetzt. Diese Regel ist gesetzlich klar vorgegeben und wurde auch vom Bundesgerichtshof bestätigt: „Da die Klägerin den Weg der fiktiven Schadensabrechnung gewählt hat, kann sie keinen Ersatz der Umsatzsteuer verlangen“ (BGH, VI ZR 91/09). Planen Sie also ein, dass ca. 19% der kalkulierten Reparatursumme nicht ausgezahlt werden. Ausnahme: Sollten Sie sich nach einem Totalschaden ein Ersatzfahrzeug kaufen, das umsatzsteuerpflichtig ist (z.B. ein Gebrauchtwagen vom Händler), können Sie die gezahlte MwSt. dafür teilweise ersetzt bekommen – meist aber nur bis zu dem Betrag, der in der Kalkulation an MwSt. angefallen wäre. Klären Sie so etwas im Voraus mit der Versicherung oder Ihrem Anwalt.
- Mietwagen ohne Reparatur: Kosten für einen Mietwagen werden bei fiktiver Abrechnung normalerweise nicht übernommen, sofern keine tatsächliche Reparatur erfolgt. Die Versicherung argumentiert, dass kein Grund für einen Ersatzwagen besteht, wenn Ihr eigenes Auto nicht in der Werkstatt ist. Wie oben erläutert, gibt es Nutzungsausfallentschädigung als Alternative, aber einen gemieteten Wagen bezahlt man Ihnen fiktiv nicht. Es gibt auch hier besondere Konstellationen (z.B. wenn das Auto fahruntüchtig ist und Sie kurzfristig einen Wagen benötigen, bevor klar ist, dass nicht repariert wird), doch im Regelfall gilt: Ohne Werkstattaufenthalt kein Mietwagenersatz.
- Kosten für nicht unfallbedingte Schäden: Die Versicherung wird genau prüfen, welche Schäden durch den Unfall verursacht wurden – nur diese müssen ersetzt werden. Vorhandene Altschäden oder unbehebbare Mängel am Fahrzeug fallen nicht darunter. Ein Gutachter vermerkt zum Glück in seinem Bericht, welche Schäden neu und unfallbedingt sind. Sollten im Gutachten Positionen auftauchen, die nichts mit dem Unfall zu tun haben, wird die Versicherung diese herausrechnen und nicht bezahlen. Sie können also nicht erwarten, dass die Versicherung z.B. eine alte Roststelle mitlackiert, nur weil der Gutachter das erwähnt hat. Es wird ausschließlich der Unfallschaden reguliert.
- Luxusreparaturen / Tuning: Wenn Sie sich entscheiden, im Zuge einer (gedachten) Reparatur gleich Verbesserungen vorzunehmen – z.B. hochwertigere Felgen als vorher – müssen Sie die Mehrkosten selbst tragen. Die Versicherung schuldet nur die Wiederherstellung des Vorzustands, nicht eine Aufwertung. Bei fiktiver Abrechnung stellt sich dieses Problem selten, weil Sie ja nicht wirklich reparieren, aber es sei der Vollständigkeit halber erwähnt: jeglicher Mehrwert, den Sie ggf. schaffen, geht auf Ihre Kappe. Umgekehrt wird übrigens manchmal ein Abzug „neu für alt“ gemacht, z.B. wenn bei der Reparatur ein altes Teil durch ein brandneues ersetzt würde (was Ihren Wagen besser stellt als vor dem Unfall). Bei fiktiver Abrechnung werden solche Abzüge aber selten relevant, da sie meist schon in der Kalkulation berücksichtigt sind.
- Nicht belegte Ausgaben: Jede Forderung muss plausibel sein. Wenn Sie z.B. behaupten, ein teurer Laptop sei im Kofferraum zu Bruch gegangen, sollten Sie einen Kaufbeleg oder Fotos vorlegen können. Was nicht nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht ist, wird die Versicherung nicht ersetzen.
Kurzum, nicht ersetzt werden insbesondere die Mehrwertsteuer (ohne Reparaturnachweis) und Mietwagenkosten (ohne Reparatur). Alles andere, was unmittelbar mit dem Unfall zusammenhängt und erforderlich war, ist grundsätzlich erstattungsfähig – solange Sie es entsprechend nachweisen und beanspruchen.
Häufige Probleme mit Versicherern
Bei der fiktiven Abrechnung kann es vorkommen, dass die Versicherung versucht, den auszuzahlenden Betrag zu kürzen oder bestimmte Positionen nicht anzuerkennen. Das liegt daran, dass Versicherungen natürlich sparsam regulieren wollen und der Meinung sind, der Geschädigte solle nicht mehr Geld bekommen als wirklich nötig. Hier sind einige typische Streitpunkte und Probleme, auf die Sie vorbereitet sein sollten:
- Verweis auf Partnerwerkstätten / günstigere Werkstatt: Sehr häufig kürzt die Versicherung die Stundenverrechnungssätze oder Lackierkosten aus dem Gutachten mit dem Argument, in einer freien (nicht markengebundenen) Werkstatt könne der Schaden günstiger behoben werden. Nach aktueller Rechtsprechung ist das unter bestimmten Voraussetzungen zulässig: Ist Ihr Auto älter als 3 Jahre und wurde es nicht stets in der Markenwerkstatt gewartet, darf die Versicherung Sie auf eine gleichwertige freie Werkstatt verweisen und nur deren niedrigere Kosten erstatten. Das gilt allerdings nur, wenn diese Werkstatt für Sie zumutbar und technisch gleichwertig ist – d.h. sie muss gut erreichbar sein und qualitativ gleichwertig arbeiten können. Wenn Ihr Fahrzeug hingegen neuwertig (unter 3 Jahre) ist oder Sie stets im Vertragshaus haben warten lassen, können Sie den vollen Stundensatz der Markenwerkstatt verlangen. Lassen Sie sich im Zweifel vom Gutachter oder Anwalt bestätigen, ob eine Verweisung rechtens ist. Oft versuchen Versicherer pauschal zu kürzen, auch wenn die Bedingungen nicht ganz erfüllt sind. Hier lohnt es sich, Widerspruch einzulegen, denn jeder Fall ist individuell.
- Kürzung von Ersatzteilaufschlägen (UPE) und Verbringungskosten: Im Gutachten werden oft UPE-Aufschläge (UPE = unverbindliche Preisempfehlung) auf Ersatzteile kalkuliert, die viele Markenwerkstätten berechnen, sowie Verbringungskosten (z.B. Kosten, um das Fahrzeug zum Lackierer zu bringen). Versicherer streichen diese Posten gerne aus der fiktiven Abrechnung mit der Begründung, dass bei Nutzung ihrer Partnerwerkstatt solche Kosten nicht oder geringer anfallen würden. Das heißt, sie zahlen z.B. keine Verbringungskosten, weil die vorgeschlagene Alternativwerkstatt alles in-house erledigt, oder sie streichen den 10% Teile-Aufschlag, den die Markenwerkstatt kalkuliert hat. Rechtlich ist das umstritten – es hängt von der Region und dem Werkstattvergleich ab. Wenn Ihr Gutachter attestiert, dass in Ihrer Region diese Aufschläge üblich sind, können Sie argumentieren, dass sie erstattungsfähig sind. Viele Gerichte geben den Versicherern aber recht, sofern eine günstigere Reparaturalternative vorhanden ist.
- Stundensatz-Differenzen: Ähnlich wie oben versuchen Versicherer, Arbeitslohnkosten zu drücken. Beispiel: Ihr Gutachten rechnet mit 130 € pro Stunde (Markenwerkstatt), die Versicherung meint 100 € (freie Werkstatt) reichen. Auch hier gilt: Wenn die Alternativwerkstatt vergleichbar ist, kann die Kürzung rechtens sein. Ist Ihr Fahrzeug aber z.B. ein Premiummodell oder immer scheckheftgepflegt beim Hersteller, können Sie dagegenhalten, dass Ihnen auch im Gutachten die Markenstunden zustehen.
- Wertminderung wird angezweifelt: Manche Versicherungen stellen sich quer, eine merkantile Wertminderung zu zahlen, gerade bei fiktiver Abrechnung. Sie argumentieren dann etwa, wenn nicht repariert werde, entstünde auch keine klassische Wertminderung. Diese Sichtweise ist jedoch falsch, wie Gerichte bestätigten – der Minderwert ist zu ersetzen, sofern das Gutachten ihn ausweist. Lassen Sie sich also nicht abwimmeln: Ein anerkannter Minderwert (typischerweise bei neueren Fahrzeugen) gehört zum Schaden und muss bezahlt werden.
- Nutzungsausfall nur bei Nachweis: Wie erwähnt, zahlen viele Versicherer eine Nutzungsausfallentschädigung nur, wenn Sie belegen, dass Sie repariert haben. Falls Sie ohne Reparatur Nutzungsausfall fordern, könnte es zu Diskussionen oder Ablehnung kommen. Hier muss man im Zweifel abwägen, ob ein Streit lohnt oder ob man auf diesen Posten verzichtet, wenn man ohnehin weitergefahren ist.
- Verspätete Gutachten oder Gutachter der Versicherung: Einige Versicherer versuchen, erst einen eigenen Gutachter zu schicken oder verlangen, das beschädigte Fahrzeug zu besichtigen, bevor sie zahlen. Sie sind jedoch nicht verpflichtet, auf den Versicherungsgutachter zu warten, wenn Sie bereits einen eigenen beauftragt haben. Sie sollten der Versicherung natürlich die Gelegenheit geben, das Gutachten zu prüfen. Manchmal dauert die Regulierungsentscheidung aber länger, weil intern geprüft wird. Hier ist Geduld gefragt – oder Druck durch einen Anwalt, wenn es zu lange dauert.
- Allgemeine Verzögerungen oder Vergleichsangebote: Mitunter zögern Versicherungen Zahlungen hinaus oder machen Ihnen ein Vergleichsangebot („Wir zahlen sofort Summe X, wenn Sie auf weitere Ansprüche verzichten“). Solche Angebote liegen oft leicht unter dem Gutachtenbetrag. Seien Sie vorsichtig: Sie müssen sich nicht vorschnell auf Abschläge einlassen. Solange Ihre Forderung berechtigt und belegt ist, haben Sie Anspruch auf den vollen Betrag. Nur wenn unklare Punkte bestehen, kann ein kleiner Nachlass z.B. eine schnelle Einigung bringen – das ist eine individuelle Entscheidung.
Tipp: Lassen Sie sich von solchen Versicherungstaktiken nicht verunsichern. Es ist durchaus üblich, dass bei fiktiver Abrechnung um jeden Posten gerungen wird. Der Versicherer will sparen, Sie wollen Ihren vollen Schaden ersetzt – irgendwo in der Mitte oder vorm Gericht trifft man sich, wie es salopp heißt. Scheuen Sie nicht davor zurück, einen Anwalt einzuschalten, wenn die Versicherung unberechtigt kürzt. Im Haftpflichtfall muss die Versicherung auch die Anwaltskosten zahlen, sodass für Sie kein Kostenrisiko entsteht. Ein Anwalt oder ein Schadenservice (wie unfall123.de) kann oft schon mit einem Schreiben erreichen, dass die Versicherung nachbessert. Viele der oben genannten Kürzungen (Werkstattverweise, UPE etc.) sind Ermessensfragen, die im Streitfall gerichtlich geklärt würden. Versicherer kalkulieren, dass ein Teil der Geschädigten die Kürzungen akzeptiert. Wenn Sie aber begründet widersprechen (z.B. mit Hilfe eines Rechtsbeistands), lenkt die Versicherung oft ein – vor allem wenn Ihre Position durch aktuelle Urteile gedeckt ist.
Schritt-für-Schritt Anleitung zur fiktiven Abrechnung
Wie geht man nun konkret vor, wenn man den Schaden fiktiv abrechnen möchte? Hier eine schrittweise Anleitung, die Ihnen als Richtschnur dienen kann:
- Unfall dokumentieren: Stellen Sie direkt nach dem Unfall sicher, dass Sie alle wichtigen Informationen sammeln. Tauschen Sie mit dem Unfallgegner Personalien und Versicherungsdaten aus. Machen Sie Fotos von beiden Fahrzeugen und der Unfallstelle. Lassen Sie die Polizei kommen, wenn es Unklarheiten in der Schuldfrage gibt oder hohe Schäden/Verletzte vorliegen. All das hilft später bei der Schadenregulierung.
- Schadenmeldung vornehmen: Informieren Sie zeitnah die gegnerische Versicherung über den Unfall und Ihren Schaden. Das kann formlos telefonisch oder schriftlich geschehen. Nennen Sie das Unfalldatum, Ort, Beteiligte, und dass Sie Schadenersatz verlangen. Sie müssen sich nicht detailliert äußern, aber die Versicherung muss von dem Unfall erfahren. Alternativ können Sie einen Anwalt oder Dienstleister (z.B. unfall123.de) mit der Schadenmeldung beauftragen – dann übernimmt dieser die Kommunikation.
- Entscheidung für fiktive Abrechnung treffen: Überlegen Sie, ob Sie reparieren lassen möchten oder nicht. Oft ist dies bereits klar (z.B. altes Auto mit Parkschrammen – lieber Geld nehmen). Wenn Sie unsicher sind, können Sie zunächst ein Gutachten einholen und dann immer noch entscheiden. Kommunizieren Sie der Versicherung gegenüber ruhig, dass Sie fiktiv abrechnen möchten. Das stellt sicher, dass sie nicht auf eine Werkstattreparatur pocht oder einen Mietwagen anbietet, den Sie nicht brauchen.
- Sachverständigen beauftragen: Suchen Sie sich einen unabhängigen Kfz-Gutachter und lassen Sie Ihr Fahrzeug begutachten (sofern der Schaden nicht minimal ist). Der Gutachter kommt meist innerhalb weniger Tage zu Ihnen oder in die Werkstatt Ihres Vertrauens, nimmt den Schaden auf und erstellt innerhalb etwa 1 Woche das Gutachten. Achten Sie darauf, dass der Gutachter amtlich anerkannt oder zertifiziert ist und Erfahrung mit Unfallgutachten hat. (Unfall123.de kann Ihnen z.B. einen qualifizierten Sachverständigen vermitteln.)
- Gutachten prüfen und verstehen: Sobald Sie das Gutachten erhalten, gehen Sie es aufmerksam durch. Notieren Sie die wichtigen Zahlen: Reparaturkosten (netto/brutto), Wiederbeschaffungswert, Restwert, Nutzungsausfall pro Tag, Wertminderung. Diese Werte bestimmen, was Sie verlangen können. Falls das Gutachten einen Totalschaden ausweist, überlegen Sie, ob Sie das Fahrzeug behalten oder verkaufen wollen – die Auszahlung der Versicherung richtet sich danach.
- Schadensersatzansprüche auflisten: Erstellen Sie eine Übersicht aller Ansprüche, die Sie geltend machen wollen. Das umfasst: den netto Reparaturkostenbetrag (oder bei Totalschaden die Differenz Wiederbeschaffungswert minus Restwert), die Wertminderung, die Gutachterkosten (Rechnung beifügen), ggf. Nutzungsausfall für X Tage (falls nachweisbar/beansprucht), die Unkostenpauschale (~25 €) und sonstige Sachschäden (mit Belegen). Auch Anwaltskosten gehören dazu, falls Sie einen Anwalt beauftragt haben – dieser rechnet das aber meist direkt mit der Versicherung ab.
- Forderungsschreiben an die Versicherung senden: Formulieren Sie ein Anschreiben an die gegnerische Versicherung, in dem Sie die Zahlung der aufgeführten Beträge verlangen. Legen Sie Kopien des Gutachtens und aller Rechnungen/Belege bei. Geben Sie Ihre Bankverbindung für die Auszahlung an. Setzen Sie eine Frist (z.B. 2-3 Wochen) zur Regulierung. Bleiben Sie sachlich, aber bestimmt in Ton und Forderung.
- Reaktion der Versicherung abwarten: Die Versicherung wird Ihren Anspruch prüfen. Möglicherweise erhalten Sie einen Anruf vom Schadenssachbearbeiter, der Rückfragen hat oder einen eigenen Gutachter schicken will. Bleiben Sie bei Ihrer Linie: Das Gutachten liegt vor, Sie wünschen Auszahlung auf dieser Basis. Sollte ein Versicherungs-Gutachter Ihr Auto sehen wollen, können Sie dem grundsätzlich zustimmen, solange das keine unzumutbare Verzögerung darstellt. Oft aber entscheidet die Versicherung aufgrund Ihres Gutachtens.
- Kürzungsangebot oder Zahlungseingang prüfen: Im besten Fall überweist die Versicherung innerhalb der Frist den geforderten Betrag (oder schickt zunächst einen detaillierten Abrechnungsvorschlag). Häufig aber kommt ein Schreiben, in dem die Versicherung bestimmte Abzüge vornimmt (z.B. „Wir zahlen nur 4.500 € statt 5.000 € wegen Werkstattverweisung“). Prüfen Sie dieses Schreiben genau. Vergleichen Sie mit Ihrem Gutachten und Ihren Forderungen. Jeder Abzug sollte begründet sein. Manchmal legen Versicherungen ihrer Berechnung ein eigenes Rechenbeispiel oder ein Prüfbericht bei.
- Ggf. Widerspruch einlegen: Sind die Kürzungen aus Ihrer Sicht unberechtigt, legen Sie Einspruch ein. Schreiben Sie der Versicherung nochmals, warum Sie den vollen Betrag verlangen. Untermauern Sie Ihren Standpunkt mit Verweisen (z.B. „Mein Fahrzeug ist erst 2 Jahre alt, daher akzeptiere ich keine Verweisung auf freie Werkstatt“ oder „die UPE-Aufschläge sind ortsüblich, siehe Gutachten“). Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie spätestens jetzt einen Rechtsanwalt einschalten oder z.B. unfall123.de um Übernahme der Kommunikation bitten. Oft zeigt schon das Hinzuziehen eines Profis Wirkung – die Versicherung merkt, dass Sie Ihre Rechte kennen.
- Abschluss der Regulierung: Im Idealfall einigt man sich mit der Versicherung auf einen Betrag, der beide Seiten zufriedenstellt (oder es wird der volle Betrag gezahlt, falls die Einwände entkräftet wurden). Die Zahlung erfolgt in der Regel per Überweisung. Kontrollieren Sie, ob tatsächlich alle Posten bezahlt wurden (manchmal „vergisst“ die Versicherung z.B. die Pauschale oder den Gutachter). Ist alles beglichen, können Sie den Schadenfall abschließen. Sollte keine Einigung erzielt werden, bleibt als letzter Schritt die Klage – darüber würden Sie aber mit Ihrem Anwalt entscheiden. In der überwiegenden Zahl der Fälle lässt sich eine Lösung ohne Gerichtsverfahren finden.
- Weiteres Vorgehen mit dem Fahrzeug: Nach der fiktiven Abrechnung liegt es bei Ihnen, was Sie mit dem Fahrzeug tun. Optionen: Sie lassen es doch reparieren (ganz oder teilweise), Sie verkaufen es unrepariert, oder Sie nutzen es weiter mit den Schäden. Beachten Sie: Wenn Sie es reparieren lassen und eine Rechnung bekommen, können Sie die darin enthaltene MwSt. noch von der Versicherung nachfordern (sofern es die ursprünglich kalkulierten Posten betrifft). Das gleiche gilt, wenn Sie innerhalb der nächsten Jahre doch noch reparieren – heben Sie Rechnungen auf. Falls Sie es verkaufen, bedenken Sie, dass der Käufer wahrscheinlich den Unfallschaden bzw. Restschaden vom Preis abzieht – aber Sie haben ja dafür die Entschädigung bekommen. Wichtig: Sollte Ihr Fahrzeug irgendwann erneut in einen Unfall geraten, können Schäden, die vom ersten Unfall unrepariert blieben, nicht ein zweites Mal abgerechnet werden. Dies sollten Sie im Hinterkopf behalten, wenn Sie mit unreparierten Vorschäden weiterfahren.
Diese Schritt-für-Schritt-Liste mag umfangreich wirken, aber keine Sorge: Viele Schritte laufen automatisch oder werden von Profis begleitet. Insbesondere wenn Sie einen Service wie unfall123.de nutzen, werden zahlreiche Aufgaben für Sie übernommen – vom Gutachter bis zur Kommunikation mit der Versicherung.
Vorteile der fiktiven Abrechnung
Die Entscheidung, sich den Schaden auszahlen zu lassen, bietet einige Vorteile, die je nach Situation sehr attraktiv sein können:
- Finanzielle Flexibilität: Sie erhalten einen Geldbetrag, den Sie nach Belieben verwenden können. Sie müssen das Geld nicht zwingend für eine Reparatur ausgeben. Wenn der Schaden Sie kaum stört oder Sie ihn kostengünstig privat beheben können, bleibt unter Umständen ein Überschuss übrig, den Sie anderweitig nutzen können. So können Geschädigte durch geschicktes Wirtschaften teilweise sparen oder sogar etwas „verdienen“ (im rechtlichen Rahmen natürlich, eine Bereicherung über den Schaden hinaus ist nicht Sinn der Sache, aber Einsparungen sind erlaubt).
- Keine sofortige Werkstattbindung: Sie sind nicht gezwungen, Ihr Auto sofort reparieren zu lassen. Gerade bei zeitlichem Engpass oder wenn Sie auf das Auto angewiesen sind, können Sie es weiter nutzen, ohne Werkstattaufenthalt. Sie vermeiden also Ausfallzeit – kein lästiges Warten auf einen Werkstatttermin, keine organisatorischen Umstände mit Ersatzwagen (sofern das Fahrzeug noch fahrbereit ist).
- Eigenbestimmung über Reparaturumfang: Sie können selbst entscheiden, ob und wie Sie reparieren. Vielleicht möchten Sie nur die technischen Schäden beheben, aber auf kosmetische Lackierarbeiten verzichten, um Geld zu sparen. Oder Sie kennen einen günstigen fähigen Mechaniker im Freundeskreis. Mit der fiktiven Auszahlung haben Sie freie Hand, was am Fahrzeug gemacht wird. Sie müssen der Versicherung keine Rechenschaft ablegen, was Sie mit dem Geld tun.
- Lukrativ bei älteren Fahrzeugen: Bei älteren Autos übersteigen die Reparaturkosten oft den Wertverlust, den der Schaden tatsächlich für Sie bedeutet. Ein großer Kratzer mindert den Gebrauchswert wenig, aber eine Fachreparatur wäre teuer. Hier ist es sinnvoll, das Geld zu nehmen. Viele Experten sagen, eine fiktive Abrechnung bietet sich besonders bei älteren Fahrzeugen oder kleineren Schäden an. Sie können das Geld möglicherweise ins nächste Auto investieren, anstatt es in ein kaum wertsteigerndes Reparaturlackieren zu stecken.
- Vermeidung von „Verbastelung“: Manche Autobesitzer haben Sorge, dass eine Reparatur (insbesondere bei nicht perfekten Werkstätten) Spuren hinterlässt oder nicht 100% werksgetreu ist. Durch fiktive Abrechnung können Sie vermeiden, dass Ihr intaktes Originalfahrzeug auseinandergebaut wird – falls Sie mit kleineren Dellen leben können. So bleibt z.B. der Originallack (mit Schaden) vielleicht lieber dran, als ein nachlackiertes Teil.
- Schnelle Entschädigung: Eine fiktive Abrechnung kann oftmals schneller abgeschlossen werden als der Weg über die Werkstatt. Sie müssen nicht auf Teilebestellungen und Reparaturdurchführung warten, bis abgerechnet wird, sondern erhalten den Betrag auszahlt, sobald die Versicherung reguliert hat. Das kann Ihnen früher Liquidität verschaffen.
- Kein Streit um Reparaturqualität: Wenn das Auto repariert wird, gibt es manchmal Diskussionen über verbleibende Mängel oder Minderwert. Bei der fiktiven Abrechnung entfallen solche Themen – Sie haben Ihr Geld, und eventuelle Restschäden sind Ihr eigener Entschluss. Sie müssen sich nicht mit der Versicherung über die Qualität der Reparatur auseinandersetzen.
Zusammengefasst bietet die fiktive Abrechnung also Flexibilität und die Möglichkeit, wirtschaftlich sinnvollere Lösungen zu finden, als streng nach Gutachten reparieren zu lassen. Viele Privatleute nutzen das z.B., um einen kosmetischen Schaden am alten Auto gar nicht mehr reparieren zu lassen und das Geld lieber in den Kauf des nächsten Wagens zu stecken. Solange die Sicherheit nicht leidet, ist das legitim. Wichtig ist nur, realistisch abzuwägen, ob man mit dem unreparierten Schaden leben kann.
Risiken und Nachteile
Neben den Vorteilen gibt es auch einige Nachteile und Risiken bei der fiktiven Abrechnung, die Sie kennen sollten:
- Netto statt Brutto – weniger Geld: Der wohl größte „Nachteil“ ist, dass Sie die Mehrwertsteuer nicht erhalten. Das sind 19% weniger als die ausgewiesenen Bruttoreparaturkosten. Wenn Sie das Fahrzeug später doch reparieren (lassen) müssen, fehlt Ihnen dieser Betrag eventuell. Wer fiktiv abrechnet, muss also damit leben, dass die Auszahlung niedriger ist als eine entsprechende Reparaturrechnung brutto – oder später die MwSt. vorstrecken, bis man sie nachträglich abrechnen kann.
- Mögliche Kürzungen durch Versicherer: Wie im vorigen Abschnitt beschrieben, versuchen viele Versicherer, bei fiktiver Abrechnung jeden Cent zu sparen. Das Risiko von Streitigkeiten und Verzögerungen ist höher als wenn man einfach eine Werkstattrechnung einreicht (die wird meist anstandslos bezahlt, sofern angemessen). Bei fiktiver Abrechnung müssen Sie oft kämpfen, um die vollen berechtigten Beträge zu erhalten. Das kann Nerven kosten und erfordert Beharrlichkeit (oder den Einsatz eines Anwalts). Wenn Sie darauf keine Lust haben, ist die konkrete Reparatur manchmal der einfachere Weg.
- Kein Mietwagen ohne Reparatur: Sie bekommen keinen Ersatzwagen gestellt, solange Sie nicht tatsächlich reparieren. Wenn Ihr Auto also nicht fahrbereit ist und Sie fiktiv abrechnen, müssen Sie entweder selbst für Mobilität sorgen (ÖPNV, Mietwagen auf eigene Kosten) oder eben doch reparieren lassen, um einen Anspruch auf Mietwagenkosten zu haben. Fiktiv abzurechnen macht vor allem Sinn, wenn Ihr Wagen noch fahrbereit ist oder Sie auf ihn verzichten können, ohne auf teure Mietwagen angewiesen zu sein.
- Unreparierter Schaden am Fahrzeug: Entscheiden Sie sich, nicht zu reparieren, bleibt der Schaden am Fahrzeug sichtbar bzw. vorhanden. Das kann zu Folgeproblemen führen: Offensichtliche Schäden mindern den Wert beim Verkauf deutlich (mehr als ein reparierter Schaden, wobei Sie dafür ja Geld bekommen haben). Ein unrepariertes Auto kann auch bei einer erneuten Beschädigung problematisch werden – neue Schäden können sich mit alten überlagern, und dann zahlt ggf. keine Versicherung nochmal. Außerdem kann ein unreparierter Schaden z.B. zu Korrosion führen (Lackschäden) oder die Verkehrssicherheit beeinträchtigen, wenn z.B. Beleuchtung, Knautschzonen oder Achsen betroffen sind. Sie sollten also gut überlegen, ob ein Schaden wirklich unrepariert bleiben kann oder ob Sie zumindest das Nötigste instand setzen (vielleicht günstiger als vom Gutachter veranschlagt).
- Zukünftiger Wertverlust: Während Sie bei einer Reparatur ggf. nur einen merkantilen Minderwert hinnehmen müssen, führt ein nicht reparierter Unfallschaden zu einem direkten Wertverlust Ihres Fahrzeugs entsprechend den Reparaturkosten. Zwar haben Sie Geld erhalten, aber dieses Geld steckt ja nicht im Auto. Wenn Sie den Wagen behalten, haben Sie quasi den Schaden „monetarisiert“. Beim Verkauf müssen Sie den Schaden dem Käufer offenbaren. Oft erwarten Käufer dann einen kräftigen Preisnachlass – in etwa der Höhe der Reparaturkosten. Das haben Sie zwar ausgezahlt bekommen, aber es bedeutet auch: Aus dem Auto ziehen Sie beim Verkauf entsprechend weniger. Anders gesagt, das Geld der Versicherung gleicht nur den Wertverlust aus, und wenn Sie nicht reparieren, tragen Sie diesen Wertverlust bei Veräußerung vollständig. Fiktive Abrechnung lohnt sich daher finanziell meist nur, wenn Sie nicht vorhaben, das Auto bald zu verkaufen, oder wenn Sie es sehr günstig selbst reparieren (sodass der tatsächliche Wertverlust geringer ausfällt als die erhaltene Summe).
- Kein „Neuwagenschutz“: Bei sehr neuen Fahrzeugen (jünger als 2-3 Jahre) ist es oft ratsam zu reparieren, um den Wagen neuwertig zu erhalten. Fiktiv abzurechnen und einen Neuwagen mit Schaden weiterzufahren macht selten jemand, allein schon wegen der Garantie und dem Wert. Zudem würden Versicherer bei Neuwagen kaum Werkstattkürzungen vornehmen dürfen – man bekäme also bei konkreter Reparatur den vollen Top-Service bezahlt. Hier kann fiktive Abrechnung nachteilig sein, weil Sie auf Premium-Leistungen verzichten (z.B. Originalteile inkl. MwSt.) und am Ende ein beschädigtes fast neues Auto haben.
- Aufwand und Wissen notwendig: Fiktiv abzurechnen erfordert, dass man sich selbst kümmert – Gutachter organisieren, Schriftverkehr mit Versicherung, ggf. Anwalt einschalten, Nachhaken bei Zahlungen. Wenn man das scheut, ist die konkrete Reparatur (wo viel von der Werkstatt übernommen wird) einfacher. Mit einem Dienstleister wie unfall123.de kann man den Aufwand allerdings auslagern; dann fällt dieser Punkt weniger ins Gewicht.
- Keine Nachbesserung durch die Versicherung: Haben Sie fiktiv Geld erhalten und später stellt sich heraus, dass verdeckte Schäden übersehen wurden, kann es schwieriger sein, noch Nachforderungen zu stellen, als wenn das Auto in Reparatur wäre (dort würde die Werkstatt ein Supplement anmelden). Es ist zwar möglich, auch nachträglich weitere Schäden geltend zu machen, aber nur solange die Sache nicht abschließend erledigt ist und man es nachweisen kann. Bei fiktiver Abrechnung „schläft“ so mancher Fall ein, und möglicherweise bemerken Sie einen technischen Folgeschaden erst viel später – dann könnte es Probleme geben, das nochmals aufzuwärmen. Bei Reparatur werden solche Dinge meist direkt entdeckt.
Alles in allem sollte man die fiktive Abrechnung nicht nur durch die rosarote Brille sehen. Sie ist kein Vorteilsgeschäft, sondern nur eine Alternative der Schadenabwicklung. Man verzichtet auf bestimmte Leistungen (MwSt, Mietwagen), hat dafür aber Freiheit beim Umgang mit dem Geld. Jeder Geschädigte muss seine Prioritäten abwägen: Geld sofort vs. Auto instandgesetzt, eigene Mühe vs. Komfort, kleiner Gewinn vs. möglicher Wertverlust usw. Im Zweifel kann auch Ihr Sachverständiger oder Anwalt einschätzen, was in Ihrem speziellen Fall sinnvoller ist.
Beispielrechnung
Um die Unterschiede zwischen konkreter Reparatur und fiktiver Abrechnung zu verdeutlichen, folgen zwei Beispiele mit Zahlen:
Beispiel 1: Reparaturschaden auszahlen lassen
Ihr Pkw wurde unverschuldet beschädigt. Das Gutachten beziffert die Reparaturkosten auf 6.000 € netto (also 7.140 € brutto mit 19% MwSt.). Der Wiederbeschaffungswert beträgt 12.000 €, es liegt kein Totalschaden vor. Im Gutachten steht außerdem eine merkantile Wertminderung von 500 € und eine empfohlene Reparaturdauer von 5 Tagen (Nutzungsausfall 5 × 43 € = 215 €, entsprechend der Fahrzeugklasse).
- Konkrete Abrechnung (Reparatur): Sie lassen das Fahrzeug in der Werkstatt reparieren und erhalten eine Rechnung über 7.140 € (6.000 € + 1.140 € MwSt.). Die Versicherung übernimmt diesen Betrag vollständig. Zusätzlich würde sie Ihnen die 5 Nutzungsausfall-Tage oder einen Mietwagen erstatten (z.B. 215 € Nutzungsausfall) und die Gutachterkosten. Die Wertminderung von 500 € steht Ihnen ebenfalls zu, da Ihr Wagen trotz Reparatur einen geringeren Marktwert hat. Insgesamt bekämen Sie also 7.140 € + 215 € + 500 € + Gutachterkosten + Pauschale etc. ersetzt. Ihr Auto ist repariert, und Sie tragen keine Kosten.
- Fiktive Abrechnung (Auszahlung): Sie entscheiden sich, den Schaden fiktiv abzurechnen. Die Versicherung zahlt Ihnen die netto Reparaturkosten von 6.000 € aus – ohne MwSt.. Außerdem erhalten Sie die merkantile Wertminderung von 500 € ausgezahlt. Die Gutachterkosten (sagen wir 800 €) und die Unkostenpauschale (~25 €) werden ebenfalls überwiesen. Nutzungsausfall: Da Sie vorerst nicht reparieren, wird die Versicherung hier skeptisch sein. Wenn Sie nachweisen, dass Sie den Wagen in etwa repariert und 5 Tage nicht genutzt haben, könnten Sie 215 € dafür fordern; ohne Nachweis wird sie diesen Posten verweigern. Nehmen wir an, Sie verzichten auf Nutzungsausfall mangels Reparatur. Ergebnis: Sie bekommen rund 6.000 + 500 + 800 + 25 = 7.325 € ausgezahlt (netto). Dies ist weniger als die Summe im Reparaturfall (weil MwSt. und Nutzungsausfall fehlen), aber Sie können frei darüber verfügen. Sie entscheiden, mit dem Geld zunächst nicht zu reparieren. Das Auto hat noch den Schaden, fährt aber noch einwandfrei. Ein Jahr später verkaufen Sie den Wagen mit dem Unfallschaden und erzielen statt 12.000 € nur 10.000 €. Dieser Verlust von 2.000 € entspricht ungefähr dem, was an Reparaturwert fehlte – aber Sie hatten ja 6.000 € erhalten. Unterm Strich sind Sie also finanziell nicht schlechter gestellt, als hätten Sie repariert und das Auto für 12.000 € verkauft (12.000 Verkauf ohne Schaden vs. 10.000 mit Schaden + 2.000 Differenz aus Versicherungszahlung). Hätten Sie das Auto behalten, hätten Sie die 6.000 € als Ausgleich für den Wertverlust in der Tasche – aber der Wagen hat eben den Schaden behalten.
- Nachträgliche Reparatur möglich: Nehmen wir an, Sie ändern Ihre Meinung und wollen den Wagen doch reparieren lassen. Sie können dies tun und z.B. eine günstigere Werkstatt finden, die es für 5.000 € brutto erledigt. Von der Versicherung bekämen Sie dann die MwSt. auf die 5.000 € (= 798 €) nachgezahlt, aber nur bis maximal zur ursprünglich kalkulierten MwSt. (1.140 €). Da Ihre Rechnung niedriger ist, wären 798 € voll erstattungsfähig. Die 6.000 € haben Sie ja schon. Sie hätten dann 6.000 + 798 = 6.798 € von der Versicherung bekommen, die Reparatur bezahlt 5.000 € – es blieben 1.798 € übrig. Davon müssten aber evtl. Leihwagenkosten gedeckt werden, falls Sie einen hatten. Dieses Beispiel zeigt, dass Eigeninitiative sparen kann, aber es ist kein „Gewinn“, sondern eher ein Lohn für eigene Mühe oder Verzicht (Sie haben z.B. auf Premiumlackierung verzichtet oder Gebrauchtteile verwendet, etc.).
Beispiel 2: Wirtschaftlicher Totalschaden
Ihr Fahrzeug (Wert vor Unfall 8.000 €) wurde so schwer beschädigt, dass die Reparaturkosten 10.000 € netto betragen würden. Das Gutachten stellt einen wirtschaftlichen Totalschaden fest, Restwert 2.000 €.
- Abrechnung auf Totalschadenbasis: Die Versicherung zahlt Ihnen Wiederbeschaffungswert minus Restwert, also 8.000 – 2.000 = 6.000 €. Dafür können Sie sich ein ähnliches Auto wiederbeschaffen. Die 2.000 € bekommen Sie, wenn Sie den Unfallwagen an einen Aufkäufer verkaufen (oft vermittelt die Versicherung entsprechende Gebote). Nutzungsausfall gibt es im Totalschadensfall für die Wiederbeschaffungsdauer, meist ca. 14 Tage, aber nur wenn Sie tatsächlich ein Ersatzauto anschaffen und dies nachweisen. Nehmen wir an, Sie kaufen innerhalb 2 Wochen einen Wagen und erhalten 14 × 35 € = 490 € Nutzungsausfall obendrauf. MwSt. auf den Kaufpreis des neuen Wagens würde ggf. anteilig erstattet, wenn sie anfällt (dies nur am Rande).
- 130%-Reparatur (konkret, nicht fiktiv): Angenommen die 10.000 € Reparaturkosten lägen unter 130% des Wertes (8.000 × 1,3 = 10.400 €, hier wären 10.000 = 125% < 130%). Dann könnten Sie – nur durch tatsächliche Reparatur! – die 10.000 € ersetzt bekommen, sofern Sie das Auto komplett fachgerecht instand setzen und weiter nutzen. Fiktiv stünde Ihnen diese Summe nicht zu, da sie über dem Wiederbeschaffungswert liegt.
In diesem Totalschadenbeispiel gibt es fiktiv kaum Spielraum: Sie erhalten 6.000 € und behalten den kaputten Wagen (Restwert 2.000 €). Wenn Sie ihn nicht reparieren, haben Sie ein Fahrzeug mit schweren Schäden. Realistisch würde man hier das Fahrzeug verkaufen (für ~2.000 €) und zusammen mit den 6.000 € ein Ersatzfahrzeug finanzieren. Die fiktive Abrechnung ist in Totalschadensfällen also im Grunde eine normale Totalschadenregulierung – man repariert ja nicht. Der Vorteil der 130%-Regel entfällt, wenn man nicht repariert. Dieses Beispiel zeigt: Bei hohen Schäden ist fiktiv abrechnen oft gleichbedeutend mit einem Fahrzeugverlust und Ersatzbeschaffung – das Geld ist dann dafür gedacht, einen „neuen“ Wagen anzuschaffen.
Jeder Fall ist etwas anders, aber diese Beispiele sollen illustrieren, worauf es hinausläuft: Mit fiktiver Abrechnung bekommen Sie den Netto-Schaden ersetzt, und Sie können finanziell profitieren, wenn Sie günstig reparieren oder auf Reparaturen verzichten, tragen aber alle Konsequenzen (z.B. geringerer Fahrzeugwert) selbst.
Tipps zur erfolgreichen Abwicklung
Abschließend einige praktische Tipps, damit Ihre fiktive Abrechnung reibungslos und zu Ihren Gunsten verläuft:
- Tipp 1: frühzeitig Beratung einholen. Zögern Sie nicht, bei Unsicherheiten einen Fachmann einzuschalten. Schon unmittelbar nach dem Unfall kann eine kostenlose Rechtsberatung sinnvoll sein. Ein Anwalt kann Ihnen bestätigen, ob fiktiv abrechnen im konkreten Fall vorteilhaft ist und übernimmt auf Wunsch die komplette Kommunikation. Die Kosten trägt der Unfallgegner, wenn Sie keine Schuld haben. Sie stehen also nicht alleine da – nutzen Sie dieses Recht.
- Tipp 2: Unabhängigen Gutachter beauftragen. Wie betont: Nehmen Sie einen eigenen Sachverständigen, nicht den der Versicherung. So stellen Sie sicher, dass alle Schadenpositionen in Ihrem Sinne erfasst werden (inkl. Wertminderung etc.). Viele Versicherer bieten an, „wir schicken unseren Gutachter vorbei“ – Sie müssen das nicht akzeptieren. Höflich ablehnen und sagen, Sie hätten bereits einen unabhängigen Gutachter beauftragt. Der geringe Zeitverlust lohnt sich für ein neutrales Gutachten.
- Tipp 3: Bagatellgrenze beachten. Wenn der Schaden offensichtlich klein ist (Lackkratzer, leichte Delle) und definitiv unter ~750 € liegen dürfte, sparen Sie sich ein teures Gutachten. Holen Sie lieber ein oder zwei Kostenvoranschläge von Werkstätten ein. Diese können Sie ebenfalls fiktiv abrechnen (die Versicherung zahlt dann netto den günstigeren Kostenvoranschlag). Ein volles Gutachten in solchen Fällen führt nur zu Streit um die Gutachterkosten.
- Tipp 4: Alle Kostenpositionen aufführen. Gehen Sie strukturiert vor und listen Sie wirklich jeden Posten Ihres Schadens auf (siehe Abschnitt „Weitere Schadensposten“). Vergessen Sie nicht Kleinigkeiten wie Abschleppen, Pauschale, Wertminderung, Kennzeichen etc., wo anwendbar. Was Sie nicht einfordern, wird die Versicherung nicht freiwillig zahlen. Nutzen Sie ggf. Checklisten (manche Webseiten bieten Schadensaufstellung-Formulare) oder lassen Sie sich von Diensten wie unfall123.de helfen, damit nichts unter den Tisch fällt.
- Tipp 5: Fristen setzen und nachhalten. Geben Sie der Versicherung schriftlich eine angemessene Frist zur Zahlung (z.B. 2 Wochen nach Erhalt aller Unterlagen). So geraten Sie schneller an Ihr Geld. Sollte die Frist ohne Reaktion verstreichen, haken Sie nach – telefonisch oder mit Unterstützung eines Anwalts. Zögerliches Regulieren kommt vor, man muss als Geschädigter am Ball bleiben.
- Tipp 6: Keine vorschnellen Unterschriften. Unterschreiben Sie nichts, was Ihnen die gegnerische Versicherung ungeprüft vorlegt – z.B. eine Abfindungserklärung. Manchmal senden Versicherer Schecks oder Überweisungen mit dem Vermerk „Mit dieser Zahlung sind alle Ansprüche abgegolten“. Seien Sie vorsichtig: Prüfen Sie, ob wirklich alle Ihre Ansprüche beglichen sind, bevor Sie etwas als erledigt quittieren. Im Zweifel lassen Sie solche Schreiben vom Anwalt prüfen.
- Tipp 7: Bei Werkstattverweis prüfen. Falls die Versicherung auf eine bestimmte Partnerwerkstatt verweist und deshalb weniger zahlen will, überprüfen Sie die Bedingungen. Ist Ihr Auto sehr neu oder stets beim Vertragshändler gepflegt? Dann müssen Sie sich nicht auf eine freie Werkstatt verweisen lassen. Ist die vorgeschlagene Werkstatt weit entfernt oder unpassend? Dann ebenfalls nicht zumutbar. Legen Sie begründet Widerspruch ein, falls eine Kürzung unberechtigt scheint.
- Tipp 8: Dokumentation aufbewahren. Bewahren Sie sämtliche Unterlagen zum Schadenfall gut auf: Gutachten, Schriftverkehr, Quittungen. Machen Sie Kopien von allem, was Sie einsenden. So haben Sie im Notfall Beweise, falls etwas verloren geht oder später noch Ansprüche geltend gemacht werden (z.B. MwSt.-Nachforderung bei späterer Reparatur).
- Tipp 9: Sicherheit und Folgeschäden bedenken. Entscheiden Sie rational, ob der Wagen mit Schaden noch verkehrssicher ist. Technische Schäden (Bremsen, Fahrwerk, Beleuchtung) sollten Sie auch bei fiktiver Abrechnung umgehend reparieren (ggf. auf eigene Kosten oder teils aus der Entschädigung). Die fiktive Abrechnung soll kein Risiko für Sie schaffen. Auch Folgeschäden wie Rost sollten bedacht werden – eine notdürftige Versiegelung einer Schadstelle kann sinnvoll sein. Das kostet wenig, bewahrt aber den Restwert.
- Tipp 10: Serviceangebote nutzen. Es gibt Dienstleister wie unfall123.de, die Ihnen viel Arbeit abnehmen. Von der Gutachterbeauftragung über die Schadenmeldung bis zur Durchsetzung Ihrer Ansprüche begleiten solche Services Privatpersonen. Das kann stressige Telefonate und Schriftwechsel ersparen. Unfall123.de etwa bietet an, den Schaden zu melden, einen Gutachter zu schicken und die Auszahlung mit der Versicherung zu koordinieren – sodass Sie zu Ihrem Geld kommen, ohne sich mit jeder Detailfrage auseinandersetzen zu müssen. Nutzen Sie solche Angebote ruhig, zumal sie für Geschädigte oft kostenfrei sind (die Kosten trägt am Ende der Versicherer des Unfallgegners im Rahmen der Schadenregulierung).
Mit diesen Tipps sind Sie gut gerüstet, Ihre fiktive Abrechnung erfolgreich und möglichst vorteilhaft abzuschließen. Vorbereitung, Information und konsequentes Auftreten zahlen sich aus – Sie bekommen, was Ihnen zusteht, und vermeiden gängige Fallstricke.
Fazit
Die fiktive Abrechnung bietet Unfallgeschädigten in Deutschland die Möglichkeit, sich einen Kfz-Schaden in Geld auszahlen zu lassen, anstatt das Fahrzeug reparieren zu lassen. Rechtlich ist dies durch § 249 BGB abgesichert – Sie haben das Wahlrecht, die Schadenbehebung in Eigenregie zu organisieren oder auch ganz darauf zu verzichten und stattdessen den “erforderlichen Geldbetrag” zu verlangen. Dieser Ratgeber hat gezeigt, was dabei zu beachten ist:
Sie erhalten bei fiktiver Abrechnung die vom Gutachter kalkulierten Netto-Reparaturkosten ersetzt, zuzüglich weiterer Schadenspositionen wie Wertminderung, Gutachterkosten, Nutzungsausfall (bei Nachweis) und pauschaler Nebenkosten. Nicht ersetzt werden MwSt. (wenn keine Reparatur erfolgt) und Mietwagenkosten (ohne Reparaturnachweis). Die fiktive Abrechnung ist besonders sinnvoll, wenn der Schaden gering oder hauptsächlich kosmetisch ist, oder das Fahrzeug schon älter – kurz: wenn eine Reparatur Ihnen wenig Vorteile bringt, aber hohe Kosten verursachen würde. Durch die Auszahlung behalten Sie die Kontrolle: Sie entscheiden, was mit dem Geld geschieht und ob das Auto repariert wird oder nicht.
Allerdings kommen mit dieser Freiheit auch Pflichten und Risiken. Sie müssen Ihren Anspruch sauber begründen und nachweisen, idealerweise mit einem unabhängigen Gutachten. Sie sollten darauf gefasst sein, dass Versicherungen bei fiktiver Abrechnung genau hinsehen und oft versuchen, durch Werkstattvergleiche und andere Kniffe den Betrag zu drücken. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen – wenn Ihre Forderungen berechtigt sind, haben Sie gute Chancen, sich durchzusetzen, notfalls mit anwaltlicher Hilfe.
Dieser Ratgeber hat Ihnen einen Leitfaden von A bis Z an die Hand gegeben: von der Definition und dem rechtlichen Rahmen, über die Voraussetzungen und einzelnen Kostenarten, bis hin zu praktischen Tipps und Fallstricken. Mit diesem Wissen können auch juristische Laien verstehen, wie sie bei einer fiktiven Abrechnung vorgehen müssen und wo die Fallstricke liegen. Wichtig ist eine strukturierte Vorgehensweise: Schaden dokumentieren, Gutachter einschalten, alle Ansprüche anmelden, Kürzungen nicht einfach hinnehmen. So stellen Sie sicher, dass Sie am Ende den Betrag bekommen, der Ihnen zusteht, um den Unfall finanziell auszugleichen.
Abschließend sei betont: Sie stehen als Geschädigter nicht alleine da. Nutzen Sie Hilfsangebote – sei es ein Verkehrsrechtsanwalt (dessen Kosten der Gegner trägt) oder ein Schadenservice wie unfall123.de, der Ihnen Arbeit abnimmt. Unfall123.de bietet genau die Unterstützung, die viele Privatpersonen benötigen, um ihr Recht ohne Stress durchzusetzen: Schaden melden, Gutachten beauftragen, Auszahlung begleiten – all das können Sie vertrauensvoll in die Hände von Profis legen.
Mit einer fiktiven Abrechnung können Sie im Idealfall Zeit und Geld sparen, sofern Sie gut informiert sind und strategisch vorgehen. Wir hoffen, dieser Ratgeber von unfall123.de hat alle wichtigen Fragen beantwortet und Ihnen das Rüstzeug gegeben, Ihren Unfallschaden erfolgreich fiktiv abzurechnen. Bleiben Sie sicher unterwegs!